Neue Broschüre: Der ganz normale kapitalistische Wahnsinn
Unsere neue Broschüre „Der ganz normale kapitalistische Wahnsinn“ (ca. 122 Seiten) von Soziale Befreiung ist da. Die Broschüre könnt Ihr hier für 5-€ (inkl. Porto) auch als E-Book über Onlinemarktplatz für Bücher booklooker.de oder direkt bei uns auch als E-Book bestellen.
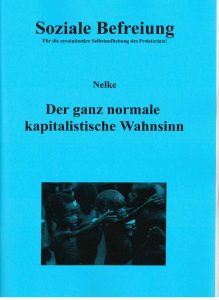
Inhalt
Einleitung
1. Die grenzenlose Vermehrung des Geldes als weitgehende Realabstraktion
2. Proletarisches Elend produziert kapitalistischen Reichtum
3. Produktives Kapital: Produktionsmittel wenden Menschen an
4. Die „unsichtbare Hand des Marktes“ und die sichtbare Faust des Staates
5. Asoziale Ware-Geld-Beziehung
6. Konkurrenz und Wahn
7. Linkspolitischer Schwachsinn
8. Die mögliche revolutionäre Selbstaufhebung des Proletariats als kollektive Therapie
Die grenzenlose Vermehrung des Geldes als weitgehende Realabstraktion
Der ganz normale Wahnsinn der kapitalistischen Produktionsweise wird besonders deutlich, wenn mensch sich ansieht, auf welche irrationale Weise sich die allgemeinen Notwendigkeiten des menschlichen Lebens in ihr durchsetzen. In allen Gesellschaftsformationen ist es notwendig, dass die Menschen in produktiver Tätigkeit die Lebensmittel und die dafür notwendigen Produktionsmittel herstellen. Diese produktive Tätigkeit kostet in allen Gesellschaftsordnungen Zeit und Kraft. Das ist auch im Kapitalismus so, nur wird dieser Fakt in Geld ausgedrückt. Eine kapitalistische Warenproduktion zerfällt in mehrere vereinzelten Wirtschaftseinheiten, die untereinander ihre Produkte austauschen. Die BesitzerInnen der einzelnen Wirtschaftseinheiten tauschen die von ihnen produzierten Güter in Geld um, um mit diesem Geld Produktionsmittel für die Reproduktion ihres Geschäfts und Lebensmittel für sich zu kaufen.
Güter und Dienstleistungen, die für den Austausch mit Geld produziert werden, sind Waren und warenförmig. Außerdem mieten die ProduktionsmittelbesitzerInnen die Arbeitskräfte von produktionsmittellosen ProletarierInnen an. Die ProduktionsmittelbesitzerInnen sind überwiegend KapitalistInnen, Kapitalgesellschaften, aber auch KleinbürgerInnen, Genossenschaften als kleinbürgerlich-kollektive Formen der Warenproduktion und gesellschaftliche Institutionen wie Parteien, Gewerkschaften und Staaten. Wenn Staaten industrielle Produktionsmittel besitzen und proletarische Arbeitskräfte anmieten, um Waren oder warenförmige Dienstleistungen zu produzieren, dann sind sie kapitalistisch. Auch wenn sie sich „sozialistisch“ nannten oder noch nennen wie die Sowjetunion, DDR oder Kuba. Die genannten Länder waren und sind in Wirklichkeit staatskapitalistisch (siehe Kapitel 4).
Geld ist ein notwendiges Tausch- und Zirkulationsmittel in einer Gesellschaft voneinander getrennter Wirtschaftseinheiten. Ohne Geld würde es passieren, dass die Bäckerin zum Tischler kommt, und für einen Stuhl 2 Stückchen Kuchen anbietet, der Tischler aber abwinkt: „Ich habe heute schon genug gegessen, und für morgen habe ich auch noch etwas. Hättest du mir eine Flasche Bier mitgebracht, hätte ich dir einen Stuhl gegeben.“ So tauschen in einer Warenproduktion die einzelnen Wirtschaftseinheiten ihre Produkte in das allgemein anerkannte Tauschmittel, in Geld, um. Mit diesem Geld kaufen beziehungsweise mieten sie sich dann die Dinge und Lebewesen, die sie brauchen, um sowohl ihre Wirtschaftseinheit (Produktionsmittel und Arbeitskräfte) ökonomisch als auch sich selbst biosozial (Lebensmittel) reproduzieren zu können. Das Geld ist dabei abstrakter Reichtum. Mensch kann es nicht essen, nicht trinken und es wärmt auch nicht. Aber mit Hilfe des Geldes kann und muss der Mensch in einer kapitalistischen Warenproduktion fast alle Güter und Dienstleistungen eintauschen, die er zum Leben braucht. Denn fast alle Güter und Gefälligkeiten sind Waren und warenförmige Dienstleistungen, die für den Austausch mit Geld produziert wurden.
Der gesellschaftliche Reichtum ist also in einer kapitalistischen Warenproduktion notwendigerweise verdoppelt in der abstrakten Form des Geldes und in konkret-stofflicher Form der Waren. Die Menschen brauchen in der kapitalistischen Warenproduktion abstrakten Reichtum in Form des Geldes, um diesen in konkret-stofflichen umzutauschen. Das ist bereits eine verdammt weitgehende kapitalistische Realabstraktion von den allgemeinen Notwendigkeiten des menschlichen Lebens. Vom abstrakten geldlichen Reichtum kann kein Mensch leben, aber ohne ihn auch nicht, weil er notwendig ist, um mit ihm den Reichtum in konkret-stofflicher Form einzutauschen. In einer kapitalistischen Warenproduktion zählen nicht die Bedürfnisse nach dem konkret-stofflichen Reichtum, wenn die Bedürftigen keinen Reichtum in abstrakt-geldlicher Form besitzen. Nein, diese Bedürfnisse zählen nicht und bleiben unbefriedigt. Im Kapitalismus zählt nur das zahlungsfähige Bedürfnis der GeldbesitzersInnen, die Nachfrage. Der Kapitalismus abstrahiert also weitgehend von den wirklichen gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnissen, wenn er nur die zahlungsfähige Nachfrage real-praktisch akzeptiert.
Das eigentliche Produktionsziel der vereinzelten Wirtschaftseinheiten ist das Geld. Waren und warenförmige Dienstleistungen werden von diesen nur produziert, um sie in Geld umzutauschen zu können. Das heißt konkreter stofflicher Reichtum wird im Kapitalismus nur produziert, damit der abstrakte Reichtum in Form des Geldes vermehrt werden kann. In allen Gesellschaftsordnungen müssen die Menschen Essen, Trinken und Kleidung produzieren, um leben zu können. Im Kapitalismus setzt sich diese Notwendigkeit auch durch. Aber in welcher wahnsinnigen Form! In einer kapitalistischen Warenproduktion werden Lebensmittel hergestellt, weil es dafür notwendig eine zahlungsfähige Nachfrage geben muss. Diese wahnsinnige Form der Durchsetzung der Notwendigkeiten des menschlichen Lebens sorgt dafür, dass einerseits Waren keine KäuferInnen finden, also umsonst produziert worden sind, und andererseits die Bedürfnisse von Geldlosen oder -armen gerade nach diesen unverkäuflichen Produkten unbefriedigt bleiben. Die Bedürfnisse nach Produkten sind da, diese auch, aber es existiert nicht genug zahlungsfähige Nachfrage nach ihnen. Deshalb werden massenhaft Produkte für die Müllhalde produziert, während gleichzeitig genauso massenhaft Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. Das ist kapitalistisch produzierter Wahnsinn!
Das eigentliche Produktionsziel einer kapitalistischen Warenproduktion ist also die Vermehrung des abstrakten Reichtums in Form des Geldes. Lebensnotwendiger konkret-stofflicher Reichtum wird nur insofern produziert, weil es dafür notwendigerweise eine zahlungsfähige Nachfrage geben muss. Das schließt auch ein, dass schädliche oder schadhafte Produkte produziert werden. Denn die einzelnen kapitalistischen, kleinbürgerlichen und institutionellen Wirtschaftseinheiten interessieren sich nicht für die nützlichen Eigenschaften einer Ware oder einer warenförmigen Dienstleistung – ihr Gebrauchswert –, sondern nur für ihr Tauschwert beziehungsweise dessen Geldausdruck, den Preis, den sie durch Verkauf erzielen. Wenn der kapitalistische Mensch einen Stuhl mit einem geringen Tauschwert – also ein Produkt, der leicht zusammenkracht – mit weniger Kosten billig produzieren lassen kann und es genug proletarische Menschen mit wenig Geld gibt, die sich bessere Stühle kaum leisten können, dann wird diese Ware hergestellt. Gehen diese Stühle dann kaputt, dann ist das nicht das Problem der kapitalistischen Möbelfabrik. Die konnte und kann durch den Verkauf ihrer Produkte weiter ihr Geld vermehren. Es wird also nicht gerade selten Pfusch hergestellt, weil die kapitalistische Produktion hauptsächlich eine von abstraktem Reichtum, von Geld ist. Die Tauschwertproduktion – also die von Gütern, die nur hergestellt werden, um sie gegen Geld zu tauschen – abstrahiert weitgehend von der notwendigen Produktion nützlicher Eigenschaften, die im Kapitalismus die Gebrauchswerte von Waren und warenförmigen Dienstleistungen darstellen. Gebrauchswerte sind nur Mittel zum Zweck der Tauschwertproduktion.
Weiter oben haben wir geschrieben, dass die Produktion von notwendigen Gütern und Dienstleistungen in allen Gesellschaftsordnungen den Menschen Kraft und Zeit kostet. Dies ist auch im Kapitalismus so, doch hier treten klassenspezifische Unterschiede auf. Die kapitalistischen und institutionellen ProduktionsmittelbesitzerInnen und deren hohen ManagerInnen arbeiten nicht mehr selbst unmittelbar-materiell-praktisch. Sie lassen fremde Menschen, die sie für Geld angemietet oder gekauft haben, an ihren Produktionsmitteln unmittelbar-praktisch arbeiten, denen die Produktion Kraft und Zeit kostet. Diesen AusbeuterInnen fremder Arbeitskraft – die Ausbeutung beschreiben wir weiter unten noch genauer – kostet die Produktion von Waren und warenförmigen Dienstleistungen Geld. Produktionsmittelbesitzende KleinbürgerInnen nehmen eine Zwischenstellung ein. Einerseits arbeiten sie noch selbst unmittelbar-praktisch an ihren eigenen Produktionsmitteln, andererseits mieten sie fremde Arbeitskraft an. Kleinbürgerlichen ProduktionsmittelbesitzerInnen – dazu gehören auch die GenossInnenschaften und andere Kooperativen als kleinbürgerlich-kollektive Formen der Warenökonomie – kostet die Produktion von Waren und warenförmigen Dienstleistungen sowohl Kraft und Zeit in der unmittelbaren Produktion als auch Geld. Geld ist für die einzelnen Wirtschaftseinheiten notwendig, um die Produktionsmittel zu kaufen und die unmittelbaren ProduzentInnen anzumieten oder zu kaufen.
Die unmittelbaren ProduzentInnen in einer kapitalistischen Warenproduktion, das waren und sind SklavInnen, doppelt freie sowie nur negativ freie Lohnabhängige. SklavInnen waren persönlich unfrei, sie gehörten ihren BesitzerInnen. Wenn SklavInnen Waren und Dienstleistungen für ihre Herren produziert hatten, so wie auf den Plantagen in Amerika vom 17. bis ins 19. Jahrhundert, dann war der Charakter dieser Sklaverei kapitalistisch (siehe Kapitel 4). In Amerika war die Sklaverei Quelle eines Agrarkapitalismus. Aber Sklaverei funktionierte auch im Industriekapitalismus. So verkauften die Nazis Industriekonzernen KZ-Häftlinge als ArbeitssklavInnen (Kapitel 6). Doch die meisten unmittelbaren ProduzentInnen des modernen Kapitalismus sind doppelt freie oder lediglich negativ freie LohnarbeiterInnen. Doppelt freie LohnarbeiterInnen sind Menschen, die einerseits im bürgerlichen Sinne persönlich frei, aber andererseits auch frei – das heißt getrennt – von den Produktionsmitteln und Lebensmitteln sind. Fast alle Lebensmittel kosten in einer kapitalistischen Warenproduktion Geld. Produktionsmittellose Menschen können weder direkt für sich Lebensmittel, noch andere Waren herstellen, nach deren Verkauf sie sich selbst die notwendigen Konsumgüter kaufen können. Ihre negative Freiheit, die Trennung von den Produktionsmitteln, führt also zum Hungertot beziehungsweise im modernen Kapitalismus zur bürokratischen Drangsalierung durch den Sozialstaat (Kapitel 4) – wenn sie ihre positive Freiheit nicht benutzen, um selbst ihre Arbeitskraft an die BesitzerInnen der Produktionsmittel zu vermieten. Die SklavInnen waren unfrei, sie wurden gekauft und verkauft. Die LohnarbeiterInnen sind doppelt frei. Ihre negative Freiheit von den Produktionsmitteln führt dazu, dass sie ihre positive Freiheit dazu benutzen müssen, ihre eigene Arbeitskraft zu vermieten. LohnarbeiterInnen sind freie Marktsubjekte, das heißt so ziemlich den Arbeitsmärkten und den Launen ihrer AusbeuterInnen unterworfen. Die Marktsubjektivität der doppelt freien LohnarbeiterInnen führt zur Ausbeutungsobjektivität, wie wir weiter unten noch analysieren wollen. Das produktive Elend der Lohnarbeit beschreiben wir in Kapitel 2.
Zu der persönlichen Freiheit von LohnarbeiterInnen gehört auch die freie Berufswahl. Doch an Orten und in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit ist diese freie Berufswahl mehr abstrakt als konkret. Der moderne deutsche Sozialstaat schränkt für Erwerbslose diese freie Berufswahl noch mehr ein, indem er sie faktisch zwingt jeden „zumutbaren“ Job anzunehmen, sonst werden die geldlichen Zuwendungen gekürzt oder ganz gestrichen. Der Übergang zu lediglich negativ freien LohnarbeiterInnen – diese sind zwar frei von Produktionsmitteln, aber auch im bürgerlichen Sinne keine freien Persönlichkeiten – ist im Kapitalismus sehr fließend. In Großbritannien war zum Beispiel die Emigration von Maschinenarbeitern bis 1815 strengstens verboten. Auf diese Weise wollte Großbritannien sein Monopol als erste kapitalistische Industrienation der Welt so lange wie möglich aufrechterhalten. Im sowjetischen Staatskapitalismus (siehe zu dessen Charakter Kapitel 4) war den LohnarbeiterInnen von 1940 bis 1956 jeder freie Arbeitsplatzwechsel untersagt, es herrschte also eine Art von industrieller Leibeigenschaft. Als lediglich negativ freie LohnarbeiterInnen können wir auch die Insassen der staatlichen Gefängnisse bezeichnen, die für Niedriglöhne schuften müssen.
Die unmittelbar-praktischen ProduzentInnen der Warenproduktion, denen die Produktionsmittel nicht gehörten und gehören – egal ob SklavInnen oder doppelt beziehungsweise lediglich negativ freie LohnarbeiterInnen – produzieren Gebrauchswerte, Tauschwerte und einen Mehrwert. Der Gebrauchswert einer Ware, ihre nützlichen Eigenschaften, ist nur Mittel zum Zweck der Tauschwertproduktion. Die Produkte werden in der Warenproduktion hergestellt, um sie in Geld zu tauschen. Die Tauschwertproduktion abstrahiert weitgehend die konkreten produktiven Tätigkeiten zur Herstellung der verschiedenen Formen des stofflich-konkreten Reichtums zur unterschiedslosen geldproduzierenden Arbeit. Eine Gießkanne ist das Ergebnis von ganz konkreten Tätigkeiten. Sie sieht ganz anders aus als ein Stuhl, ein anderes konkretes Ergebnis von konkreten produktiven Tätigkeiten. Doch in einer Warenproduktion sind Stuhl und Gießkanne für die vereinzelten Wirtschaftseinheiten, die sie herstellen ließen, nicht das wirkliche Ziel der Produktion. Sind Gießkanne und Stuhl verkauft, sind also beide in die abstrakte Form des gesellschaftlichen Reichtums verwandelt, sind die Endprodukte – zwei Geldsummen – nicht mehr qualitativ unterscheidbar. Das Endprodukt der kapitalistischen Gartengeräteherstellung ist genauso Geld wie das der Möbel-Fabrik. Die Tauschwertproduktion abstrahiert die verschiedenen konkreten produktiven Tätigkeiten zur Herstellung des stofflichen Reichtums zur unterschiedslosen geldproduzierenden Arbeit.
Durch den Tausch der Produkte gegen Geld, entsteht der Tauschwert der Waren. Der verselbständigte Ausdruck des Tauschwertes der Waren ist das Geld. Der Preis einer Ware ist der Geldausdruck ihres Tauschwertes. Wovon hängt nun die quantitative Höhe eines Warenpreises – also wie viel Geld ihre KäuferInnen hinlegen müssen – ab? Die bürgerliche Oberflächlichkeit und der Marktfetischismus sagen: Von dem Verhältnis aus Angebot und Nachfrage. Ist das Angebot von bestimmten Waren höher als ihre Nachfrage, dann sinken die Preise für sie. Wenn jedoch die Nachfrage höher ist als das Angebot, dann steigen die Warenpreise. Ja, die Warenpreise werden auch durch das Konkurrenzverhältnis aus Angebot und Nachfrage bestimmt. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wir haben zum wiederholten Male festgestellt, dass die menschliche Herstellung von Produktions- und Lebensmitteln in allen Gesellschaftsordnungen Kraft und Zeit kostet. Weiter haben wir festgestellt, dass dies auch auf die unmittelbar-praktischen ProduzentInnen einer Warenproduktion zutrifft. Den nicht unmittelbar-praktisch arbeitenden kapitalistischen und institutionellen BesitzerInnen der Produktionsmittel kostet die Produktion jedoch Geld. Und den KäuferInnen der Waren, die sie entweder weiter verkaufen (Handel) oder deren Gebrauchswerte genießen wollen, kostet deren Erwerb ebenfalls Geld. Der Erwerb dieser Waren hat sie nicht unmittelbar Herstellungskraft und -zeit gekostet. Ihr Geld bringt aber diese Produktionskosten zum Ausdruck. Denn die Warenpreise werden auch durch die durchschnittlichen, gesellschaftlich notwendigen Herstellungszeiten dieser Waren bestimmt.
Die von Smith, Ricardo und Marx formulierte Arbeitswerttheorie geht einfach nur von der Tatsache aus, dass auch in Kapitalismus die Herstellung von Produkten Kraft und Zeit kostet, dies sich aber in Geld ausdrückt. Die KäuferInnen einer Ware zahlen deren Produktionskosten – die Verausgabung von Arbeitskraft in einer bestimmten Zeit – in Geldform. Der Preis einer Ware schwankt durch die Konkurrenz aus Angebot und Nachfrage über oder unter ihrem Arbeitswert als ihrer durchschnittlichen, gesellschaftlich notwendigen Herstellungszeit. Der Arbeitswert erklärt also die Höhe der Preise als den Produktionskosten von Waren unabhängig von deren Marktschwankungen. Aber im Kapitalismus werden die Produkte selbstverständlich nicht nach ihren Arbeitswerten, sondern konkurrenzförmig zu Preisen getauscht. Alle bürgerlichen Marktsubjekte – auch doppelt freie LohnarbeiterInnen sind Marktsubjekte – wollen möglichst zu Preisen unter den Arbeitswerten einkaufen und über ihnen verkaufen. Monopole können sogar ziemlich subjektiv und einseitig die Preise festlegen. Die moderne Arbeitswerttheorie erklärt Preise von ihrer Quelle, den Produktionskosten einer Ware her, sagt aber auch eindeutig, dass Arbeitswerte und Preise aufgrund der Konkurrenz der Marktsubjekte nicht identisch sein können.
Weiter oben haben wir geschrieben, dass sowohl die Produktion einer Ware durch die KapitalistInnen als auch deren Konsum durch die EndverbraucherInnen Geld kostet. Allerdings sind die Produktionskosten der KapitalistInnen in der Regel geringer als die Kosten der KonsumentInnen. Die KonsumentInnen einer Ware bezahlen einen Preis für sie, der ungefähr den Produktionskosten der unmittelbar-praktischen ProduzentInnen entspricht – also die durchschnittliche, gesellschaftlich notwendige Herstellungszeit –, aber durch die Marktkonkurrenz aus Angebot und Nachfrage entweder darüber oder darunter liegt. Aber für die KapitalistInnen sind deren Produktionskosten in der Regel niedriger als der der unmittelbar-praktischen ProduzentInnen und KonsumentInnen. Die Differenz zwischen den Kosten ist der Gewinn, den die KapitalistInnen einstecken. Weiter oben haben wir geschrieben, dass das Geld das eigentliche Produktionsziel einer kapitalistischen Warenproduktion ist. Das war nicht ganz exakt. Es ist der Gewinn als ein Teil der Geldsumme, die existiert, sobald die kapitalistisch produzierte Ware verkauft wurde.
Der Gewinn entstand und entsteht innerhalb einer kapitalistischen Warenproduktion durch die Ausbeutung der unmittelbar-praktischen ProduzentInnen durch die BesitzerInnen der Produktionsmittel. Wurden früher die SklavInnen durch die PlantagenbesitzerInnen gekauft oder haben heute doppelt freie Lohnabhängige durch den ökonomischen Zwang der Verhältnisse ihre Arbeitskraft zum Beispiel einer Waffenfabrik vermietet, dann waren und sind die unmittelbar-praktischen ProduzentInnen menschliches produktives Kapital, die die Produktionskosten der KapitalistInnen reproduzieren und einen Gewinn/einen Mehrwert herstellen. Die Produktionskosten für die KapitalistInnen – sowohl für den damaligen Plantagenbesitzer als auch für die heutige Möbelfabrikantin – waren und sind die Preise für die Produktionsmittel und die Lebensmittelkosten für die SklavInnen beziehungsweise die Löhne für die doppelt freien LohnarbeiterInnen. Sowohl die früheren PlantagensklavInnen als auch die heutigen doppelt freien LohnarbeiterInnen übertragen die Preise der Produktionsmittel auf das neue Produkt und stellen gleichzeitig einen Neuwert her. Die Arbeitsgegenstände, in unseren Beispielen die Baumwolle und das Holz – ging und geht stofflich sowie preislich – abgesehen von Verlusten – ganz in dem neuen Produkt auf, während die Arbeitsmittel stofflich unabhängig bleiben und ihr Preis stückweise während ihrer durchschnittlichen Haltbarkeit von den unmittelbar-praktischen ProduzentInnen auf die neuen Waren übertragen wurden und werden.
In derselben Zeit, in der die unmittelbar-praktischen ProduzentInnen die Preise der Produktionsmittel auf die Produkte übertrugen und übertragen, erarbeiteten und erarbeiten sie einen Neuwert beziehungsweise einen neuen Preis. Die Arbeitszeit sowohl der damaligen PlantagensklavInnen als auch der heutigen doppelt freien Lohnabhängigen durchtrennte und durchtrennt eine unsichtbare Grenze. In der selbstreproduktiven Arbeitszeit stellten und stellen die unmittelbar-praktischen ProduzentInnen einen Preis her, der ihren Lohnkosten entspricht beziehungsweise den Lebensmittelkosten für die PlantagensklavInnen entsprach. In der Mehrarbeitszeit produzierten und produzieren sowohl die früheren PlantagensklavInnen als auch die heutigen LohnarbeiterInnen einen Mehrwert beziehungsweise einen Profit für die Baumwollplantage beziehungsweise die Möbelfabrik, den sich deren BesitzerInnen aneigneten und aneignen. Die Ausbeutung der unmittelbar-praktischen ProduzentInnen sowohl in der früheren kapitalistischen Plantagensklaverei als auch im Industriekapitalismus bestand und besteht darin, dass diese mehr Geld produzierten und produzieren als sie den KapitalistInnen kosteten beziehungsweise kosten.
Übrigens beuten auch KleinbürgerInnen schon embryonal-kapitalistisch „ihre“ LohnarbeiterInnen aus, allerdings ist die Masse des Mehrwertes zu gering, als dass sie allein von fremder unmittelbar-praktischer Arbeit leben könnten. So arbeiten die produktionsmittelbesitzenden KleinbürgerInnen im Unterschied zu den KapitalistInnen – die sich entweder der Oberleitung des Arbeits- und Ausbeutungsprozesses widmen oder selbst diese ManagerInnen übertragen – selbst noch unmittelbar praktisch. Aber sie beuten auch bereits die Lohnarbeit aus. Deshalb sind sie nicht nichtkapitalistisch, wie es einige ParteimarxistInnen behaupteten, um mit produktionsmittelbesitzenden KleinbürgerInnen ihre „antimonopolistischen Bündnisse gegen das Großkapital“ bilden zu können. Nein, produktionsmittelbesitzende KleinbürgerInnen sind embryonal-kapitalistisch und damit strukturelle KlassenfeindInen des Proletariats. Übrigens auch große Teile der ParteimarxistInnen, die den Staatskapitalismus in der Sowjetunion, in der DDR und auf Kuba verklärten und verklären, obwohl auch dort die Lohnabhängigen einen Mehrwert produzierten, die sich die „sozialistischen Staaten“ aneigneten beziehungsweise aneignen. Ein großer Teil des Parteimarxismus abstrahierte und abstrahiert ideologisch von der kapitalistischen Ausbeutung in den „sozialistischen Ländern“ durch den Staat. Dies geschieht, indem für viele ParteimarxistInnen nur das Privateigentum an industriellen Produktionsmitteln kapitalistisch ist – aber angeblich nicht das Staatseigentum in den „sozialistischen Ländern“ (siehe Kapitel 4 und 7).
Egal ob kleinbürgerliches, kapitalistisches oder Staatseigentum an Produktionsmitteln: Das Verhältnis zwischen dem Mehrwert/dem Gewinn und den Lohnkosten – wir verlassen jetzt die frühere kapitalistische Plantagensklaverei – ist die Mehrwertrate. Sie ist für KommunistInnen, die die Aufhebung der Lohnarbeit durch die mögliche revolutionäre Selbstaufhebung der LohnarbeiterInnen anstreben (siehe Kapitel 8), praktisch interessant, weil sie die kapitalistische Ausbeutung theoretisch erklärt. KapitalistInnen abstrahieren ideologisch von ihr, weil die Mehrwertrate für sie praktisch keine Bedeutung hat. Sie addieren alle ihre Produktionskosten, die mit den wirklichen Produktionskosten der LohnarbeiterInnen nicht übereinstimmen, also die Kosten für die Produktionsmittel mit den Lohnkosten und setzen diese mit ihrem Gewinn/Profit ins Verhältnis. Die Profitrate ist das Verhältnis zwischen den Profiten und den Produktionskosten der KapitalistInnen – sowohl der Produktionsmittel als gegenständliches produktives Kapital als auch der LohnarbeiterInnen als menschliches produktives Kapital. Sie ist stets niedriger als die Mehrwertrate. Während die Mehrwertrate die Quelle des kapitalistischen Gewinns offenbart – die Ausbeutung der Lohnarbeit –, abstrahiert die Profitrate von dieser ideologisch. Sie verschleiert die kapitalistische Ausbeutung der Lohnarbeit.
Wenn die kapitalistisch produzierte Ware auf dem Markt verkauft wurde, sind sowohl die Produktionskosten als auch der Mehrwert in Geld verwandelt. Die KapitalistInnen oder die kommerziellen Lohnabhängigen des Kapitals verwandeln das Geldkapital wieder in produktives Kapital, das heißt sie kaufen Produktionsmittel und zahlen den monatlichen Mietpreis der Arbeitskräfte, den Lohn. Dazu reicht – wenn die Preise oder die Löhne nicht inzwischen gestiegen sind – der Teil des Geldes, der auch schon den vergangenen Produktionskosten entsprach. Ein Teil des Mehrwertes wird von den KapitalistInnen und ihren ManagerInnen konsumiert, der andere Teil wird zur Erweiterung der Produktion genutzt, also zum Kauf von noch mehr Produktionsmitteln und zur Anmietung von neuen Arbeitskräften benutzt. Die Verwandlung eines Teiles des Mehrwertes in neues Kapital ist die Kapitalvermehrung. Kapital ist sich vermehrendes Geld. Nicht der Konsum des Mehrwertes durch die KapitalistInnen ist das Hauptziel der kapitalistischen Warenproduktion, sondern die unendliche Vermehrung des Geldes, des gesellschaftlichen Reichtums in abstrakter Form. Das ist eine sehr weitgehende Realabstraktion von den allgemeinen Notwendigkeiten des menschlichen Lebens.
Der in der Industrie, in der Landwirtschaft und in großen Teilen der Dienstleistungsbranche produzierte Mehrwert – so produziert ein lohnabhängiger Koch in einer kapitalistischen Restaurantkette neben dem Gebrauchswert auch Tausch- und Mehrwert für das Kapital – wird mit anderen Fraktionen der Bourgeoisie geteilt. So mit den HandelskapitalistInnen. Das produktiv angelegte Kapital vermehrt sich schneller, indem die produzierten Waren an den Handel verkauft werden und innerhalb des letztgenannten mehrere Stufen durchlaufen – sie also immer weiterverkauft werden – bis sie sich in der Gewalt der EndverbraucherInnen befinden. Für die schnellere Vermehrung des Kapitals durch den Handel verzichtet die Industrie-, die Agrar- und der Teil der Dienstleistungsbourgeoisie, deren Lohnabhängige Mehrwert produzieren auf einen Teil von ihm und teilen diesen mit dem Handelskapital. Die Lohnabhängigen des Handels produzieren keinen Mehrwert, sie helfen dabei ihn für „ihre“ Bourgeoisie durch den Verkauf der Waren zu realisieren. Sie werden aus dem Mehrwert bezahlt. Ihre Ausbeutung durch die HandelskapitalistInnen besteht darin, dass sie mehr Geld als Profit realisieren helfen, als dass sie es für sich selbst in Gestalt des Lohnes tun.
Ein anderer Teil des Mehrwertes, den die Lohnabhängigen der Industrie, der Landwirtschaft, der nichtfinanziellen Dienstleistungsbranche und des Handels für jeweils „ihre“ Bourgeoisie produzieren und realisieren helfen, verwandelt sich in Zinsen für das Finanzkapital. Indem die Finanzbourgeoisie den anderen KapitalistInnen Kredite gewährt, beschleunigt es bei den Letztgenannten die Kapitalvermehrung beziehungsweise hilft diesen aus Krisen heraus. Doch für den Kredit, den sie selbstverständlich auch zurückzahlen müssen, müssen sie einen Aufpreis, die Zinsen, blechen. Die kreditnehmenden KapitalistInnen zahlen die Zinsen aus einem Teil ihres Mehrwertes. Gewähren Banken Lohnabhängigen einen KonsumentInnen-Kredit, so müssen die letzteren den Zins von ihrem späteren Lohn bezahlen. In diesem Fall verwandelt sich ein Teil des Lohnes in Mehrwert für das Bankkapital. Die Lohnabhängigen der Finanzbranche produzieren keinen Mehrwert, sondern werden aus diesem bezahlt. Ihre Ausbeutung besteht darin, dass sie mehr Mehrwert für die Finanzbourgeoisie realisieren helfen als sie selbst als Lohn ausgezahlt bekommen.
In der Finanzbranche wird die Realabstraktion der grenzenlosen Geldvermehrung von den allgemeinen Notwendigkeiten des menschlichen Lebens auf die Spitze getrieben. Das Bankkapital handelt mit Geld. Die Kreditvergabe ist nur eine Form der Kapitalvermehrung innerhalb der Finanzsphäre. Diese vermehrt zum großen Teil ihr Geld durch die Spekulation mit Wertpapieren. Letztere sind Anlageformen des Geldkapitals. Aktien sind zum Beispiel handelbare Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die einen Anspruch auf einen Teil ihres Profites, die Dividende, symbolisieren. Doch die AktienspekulantInnen interessieren sich nicht in erster Linie für die Dividende, sondern sie vermehren ihr Kapital, indem sie Wertpapiere teurer verkaufen als sie sie eingekauft haben. Durch Spekulation mit Wertpapieren, können diese einen größeren abstrakten Reichtum verkörpern als er in konkreter stofflicher Form existiert. Handelbare Wertpapiere sind als eine Anlageform des Geldes eine abstrakte Form des gesellschaftlichen Reichtums mit Anspruch auf eine andere abstrakte Form, nämlich auf Geld – sowohl in Form der Dividende als auch des Spekulationsgewinns. Die Dividende, die zum Beispiel an die AktionärInnen eines Autokonzerns ausgezahlt wird, ist der verwandelte Tauschwert von stofflich-konkreten Reichtum in Form von PKWs, LKWs und anderen Fahrzeugen. Der Preis eines handelbaren Wertpapiers, ihr Kurs, kann durch Spekulation extrem weit nach oben getrieben werden, der mit der realen Mehrwertproduktion, auf dem sie einen Anspruch verkörpert, nicht mehr viel zu tun hat.
In Japan entwickelte sich zum Beispiel Mitte der 1980er Jahre eine gewaltige Spekulationsblase mit Immobilien und Aktien. Investitionen in Häuser brachten in Japan seit Beginn der 1980er Jahre 30 Prozent Profit im Jahr ein, das war wesentlich mehr als KapitalistInnen mit der Produktion von Stahl oder Autos einfahren konnten. Eine Spekulationsblase entstand, bei der vermehrt Häuser gekauft wurden, nicht um darin zu wohnen oder von den Mieteinnahmen zu leben, sondern um sie für mehr Geld weiterzuverkaufen. Eine gewaltige spekulationsgetriebene Nachfrage nach Immobilien entstand, die wiederum die Spekulation antrieb. Die Banken füllten selbstverständlich durch massive Kreditvergabe die Spekulationskassen noch ordentlich auf, was die Spekulation zusätzlich befeuerte. Auf dem Höhepunkt dieser gewaltigen Spekulationsblase war das kleine Stück Land unter dem Kaiserpalast in Japan höherbewertet als alle Grundstücke im großen US-Bundesstaat Kalifornien zusammen. Viele Bourgeois, die durch Häuserspekulation reich wurden, fragten verstärkt nach Aktien als Anlageformen für ihr Geldkapital nach, was auch die Aktienkurse nach oben trieb. Es entstand eine weitere Blase. 1989 waren japanische Aktien in ihrer Gesamtheit doppelt so hoch bewertet wie die Summe aller US-amerikanischen, und dies obwohl die USA doppelt so viel reale Waren und warenförmige Dienstleistungen produzierte als Japan. Ja, die verbrieften Ansprüche auf einen Teil des Mehrwertes waren mit der Mehrwertproduktion in ein gewaltiges Missverhältnis geraten.
Die Blase platzte, als die japanische Zentralbank 1990 Angst von dieser kreditgetriebenen Spekulation mit Aktien und Immobilien bekam und deshalb eine Obergrenze für den Anteil der Kredite, welche die Geschäftsbanken als Immobiliendarlehen (Hypotheken) vergeben durften, festlegte. Dadurch konnte das Hypothekenvolumen nicht mehr so stark steigen wie bisher. Dies genügte um den Wahnsinn zu beenden. Einen Wahnsinn, bei dem sich die Illusion in bürgerlichen Köpfen festsetzte, dass mensch aus Luft Geld machen könne. Doch dieser Wahnsinn, der sich immer wieder in einer privatkapitalistischen Gesellschaft als einem einzigen großen Irrenhaus verbreitet, wird jäh beendet durch das Hereinbrechen der Realität, bei der sich wieder sehr viel Geld in Luft auflöst. So war es auch in Japan 1990/91. Dadurch, dass durch das Eingreifen der Zentralbank die Geschäftsbanken Hypothekenkredite einschränkten, war der Häuserkauf auf Kredit nicht mehr so ohne weiteres möglich wie zuvor. Außerdem war die Methode, die alten Häuserkredite und den Zins darauf durch die Aufnahme neuer Kredite zu bezahlen, nun massenhaft vereitelt. Die Banken hatten nun eine Masse uneinbringbarer Forderungen in ihren Bilanzen stehen. Viele ImmobilienbesitzerInnen verschuldeten sich und konnten die Kredite nicht mehr zurückzahlen, wodurch viele Häuser zwangsversteigert wurden, was das Angebot an Immobilien erhöhte und dadurch deren Preise in den Keller zog. Das Platzen der Immobilienblase war auch mit einem Platzen der Aktienblase verbunden. Die Aktienkurse fielen in Japan 1990 und 1991 um jeweils 30 Prozent.
Ja, die Wertpapierspekulation kann sogar nur abstrakten Reichtum verkörpern, der jegliche stofflich-konkrete Basis total verloren hat. Die linke Politikerin und strukturelle Klassenfeindin des Proletariats, Sahra Wagenknecht, schrieb darüber: „Im 20. Jahrhundert waren es meist Aktien oder Immobilien, die den Stoff für spekulative Blasen lieferten. Eine typische Immobilienblase hatte sich beispielsweise Mitte der 20er Jahre in Florida aufgebaut. Eisenbahnen und Autos anstelle von Pferdekutschen hatten die sonnige Halbinsel näher an den Norden gerückt und höhere Einkommen sorgten dafür, dass ein Sommerhaus im Warmen für immer mehr Familien der oberen Mittelschicht erschwinglich wurde. Das war der reale Hintergrund für steigende Grundstückpreise in Florida. Die Aussicht, Bauland auf der Halbinsel morgen teurer weiterverkaufen zu können, als man es heute gekauft hatte, lockte wiederum in immer größerer Zahl Käufer auf den Markt, die in Florida gar nicht bauen, sondern einfach nur Geld machen wollten. Die Preissteigerungen eskalierten, als man dazu überging, Bauland gegen eine Anzahlung von nur 10 Prozent zu verkaufen. Immerhin konnten die Investoren mit der gleichen Geldsumme jetzt einen bis zu zehnmal höheren Preis bezahlen. Der als sicher angenommene Weiterverkauf zu noch höheren Preisen ließ Sorgen betreffs der Tilgung dieser Kredite gar nicht erst aufkommen.
Bald fanden auch völlig unwirtliche Sumpfgebiete reißenden Absatz, sofern sie nur in Florida lagen. Zwar gab es niemanden, der seine Sommerresidenz auf modrigem Grund zwischen Wasserschlangen und Krokodilen errichten wollte. Aber es gab genügend Leute, die auf einen größeren Idioten spekulierten, der ihnen diese Grundstücke teurer wieder abkaufen würde. Und eine gewisse Zeit lang ging diese Spekulation tatsächlich auf. Irgendwann allerdings ließ der Strom neuer Käufer nach, möglicherweise, weil sich an der Wall Street neue interessante Investitionsmöglichkeiten ankündigten. Ein Hurrikan beendete die Florida-Manie endgültig, die Preise stürzten ab und teuer erworbene Eigentumstitel auf unbewohnbare Landflecken waren plötzlich keinen Cent mehr Wert.“ (Sahra Wagenknecht, Wahnsinn mit Methode. Finanzcrash und Weltwirtschaft, Das Neue Berlin, Berlin 2008, S. 63/64.) Die Spekulation mit ganz offensichtlich unbewohnbaren Grundstücken stellt die höchste Form der kapitalistischen Realabstraktion von den allgemeinen Notwendigkeiten des menschlichen Lebens dar. Im Privatkapitalismus sind natürlich auch solche Verrücktheiten eine Notwendigkeit der abstrakten Reichtums-Produktion und -Zirkulation in Form des Geldes, sie gehören zum ganz normalen Wahnsinn der Kapitalvermehrung.
Auch der bürgerliche Staat lebt von dieser Kapitalvermehrung. Er eignet sich durch das Erheben von Steuern einen Teil des Mehrwertes politisch an (siehe Kapitel 4). Die regierenden und hohen oppositionellen BerufspolitikerInnen – zum Beispiel Sahra Wagenknecht – sowie die SpitzenbeamtInnen leben vom Mehrwert und verwalten die Kapitalvermehrung gesamtgesellschaftlich. Sie gehören deshalb zur Bourgeoisie wie die KapitalistInnen und großen ManagerInnen.
Die Bourgeoisie lebt für die Kapitalvermehrung. Es liegt nicht nur an der Gefahr des Bankrottes im Konkurrenzkampf, dass die Bourgeoisie die Kapitalvermehrung total verinnerlicht hat und in der Tat im Wesentlichen personifiziertes Kapital darstellt, wie ihr Angehöriger und Kritiker Friedrich Engels beschrieb: „Mir ist nie eine so tief demoralisierte, innerlich zerfressene und für allen Fortschritt unfähig gemachte Klasse vorgekommen. (…) Für sie existiert nichts auf der Welt, was nicht nur um des Geldes willen da wäre, sie selbst nicht ausgenommen, denn sie lebt für nichts, als um Geld zu verdienen, sie kennt keine Seligkeit als die des schnellen Erwerbs, keinem Schmerz außer dem Geldverlieren. Bei dieser Habsucht und Geldgier ist es nicht möglich, dass eine einzige menschliche Anschauung unbefleckt bleibt.“ Engels berichtete auch, wie er einen englischen Bourgeois durch Manchester führte und diesen auch mit dem „scheußlichen Zustand der Arbeiterviertel“ bekannt machte und dieser Mann zum Abschied sagte: „Andy et, there is a great deal of money made here“ Engels schrieb über den typischen Bourgeois, dass es ihn „durchaus gleichgültig“ sei „ob seine Arbeiter verhungern oder nicht, wenn er nur genug Geld verdient“. (Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, MEW, Band 2, Berlin (DDR) 1972, S. 486 f.)
Wenn ProletarierInnen in der Bourgeoisie etwas anderes sehen als personifiziertes Kapital, dann ist das eine für den Klassenkampf vollkommen unangebrachte Sentimentalität. Die KapitalistInnen und ManagerInnen sind Charaktermasken des Kapitals, weitgehend abstrahiert von anderen sozialen Funktionen und Genüssen außerhalb der Kapitalvermehrung, ja sie leben vorwiegend für diese. Das letztere gilt – wenn auch auf ganz andere Weise – erst recht für die Lohnabhängigen, deren Arbeit und Ausbeutung das Kapital vermehrt.
Neueste Kommentare