Neue Broschüre: 1921-2021: 100 Jahre parteifeindlicher Kommunismus
Unsere neue Broschüre „1921-2021: 100 Jahre parteifeindlicher Kommunismus“ (ca. 136 Seiten) von Soziale Befreiung ist da. Die Broschüre könnt Ihr hier für 5-€ (inkl. Porto) über Onlinemarktplatz für Bücher booklooker.de oder direkt bei uns auch als E-Book oder direkt bei uns auch als E-Book bestellen.
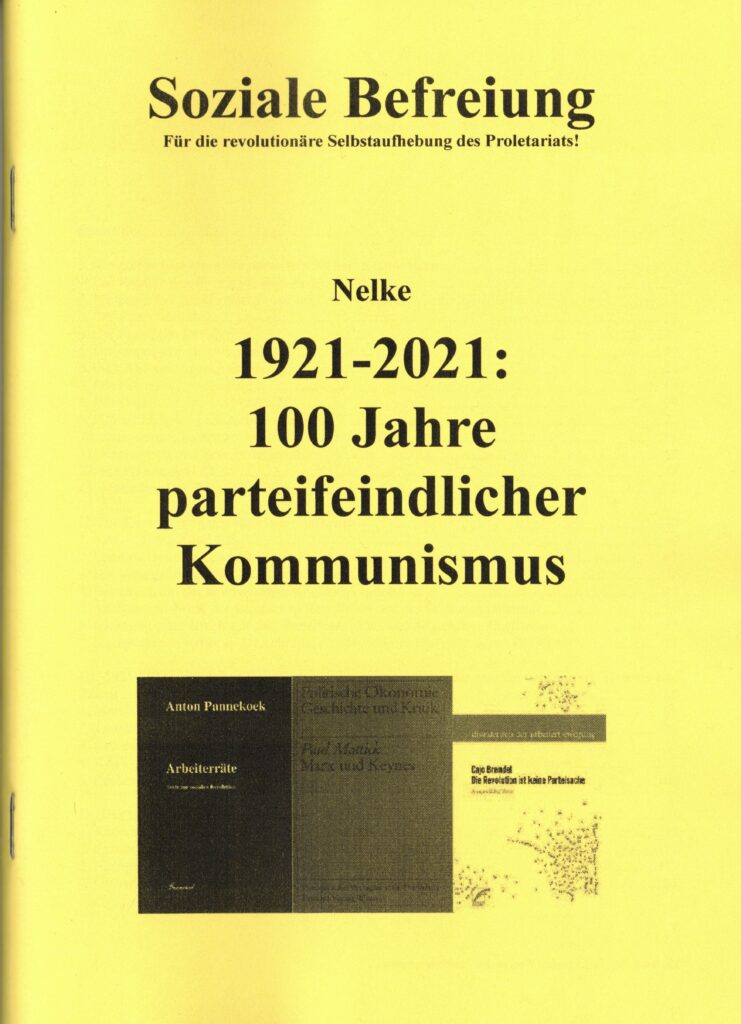
Inhalt
Einleitung
I. Der Geburtsprozess des parteifeindlichen Kommunismus
1. Die Kapitalvermehrung vor dem Ersten Weltkrieg
2. Proletarischer Klassenkampf und institutionalisierte ArbeiterInnenbewegung vor 1914
3. Der Erste Weltkrieg
4. Die Russische Revolution
5. Die ungarische „Räterepublik“
6. ISD, ASP und Spartakusbund
7. Die Novemberrevolution
8. Die Gründung von IKD und KPD
9. Klassenkämpfe in Deutschland im Jahre 1919
10. Innerparteiliche Konterrevolution in der „K“PD
11. Kappputsch und Rote Ruhrarmee
12. KAPD und AAUD
13. Märzkämpfe 1921 und Gründung der AAUE
II. Die Entwicklung des Rätekommunismus
1. AAUE, KAUD und GIK
2. Daad en Gedachte, Cajo Brendel, Paul Mattick und Willy Huhn
3. Die Verkörperung einer Kulturrevolution
4. Der Bruch mit der leninistischen Konterrevolution
5. Analyse und Kritik der Russischen Revolution und des Staatskapitalismus
6. Inkonsequenter Bruch mit dem Parteimarxismus und Anarchosyndikalismus
7. Inkonsequente Kritik an Demokratie, Antifaschismus und nationaler „Befreiung“
III. 1921-2021: 100 Jahre Dekadenz des Parteimarxismus als sozialrevolutionäre Theorie und Praxis
1. Marxismus-Leninismus
2. Trotzkismus
3. Italienischer Linkskommunismus
4. KAPD, Rote Kämpfer, MLLF, Communistenbond Spartacus und Neu Beginnen
5. Rechtsmarxismus-Linkskeynesianismus
IV. Der bewusst antipolitische Kommunismus
1. Antipolitisch und antinational
2. Konsequent gewerkschaftsfeindlich
3. Nachmarxistisch und nachanarchistisch
4. Überwindung des Rätefetischismus
Der Bruch mit der leninistischen Konterrevolution
Die sozialreaktionäre Machtübernahme der bolschewistischen BerufspolitikerInnen im Oktober 1917 – nach dem alten russischen Kalender – führte zum Staatskapitalismus (ab Sommer 1918) und der politischen Diktatur der „Kommunistischen“ Partei, die entweder die Organe der klassenkämpferischen Selbstorganisation des Proletariats zerschlug oder in das ultrabürokratische Regime integrierte (siehe Kapitel I.4). Ab 1918 war der weltweite Bruch der revolutionären ProletarierInnen und Intellektuellen mit dem bolschewistischen Regime und dessen Konterrevolution objektiv notwendig. Nun, es dauert immer ein wenig, bis sich objektive Notwendigkeiten subjektiv durchsetzen. Auch die radikalen antiparlamentarischen und gewerkschaftsfeindlichen MarxistInnen in Deutschland (KAPD/AAUD) hatten Illusionen in den „sowjetischen“ Partei-„Kommunismus“. Es war die parteifeindliche Strömung in KAPD und AAUD, die zuerst im Jahre 1920 mit dem Lenin/Trotzki-Regime brach.
So wie die parteifeindliche Strömung am Anfang noch der KAPD angehörte, so hatte sie zu Beginn ihrer Existenz auch noch Illusionen in den Bolschewismus. Bis Otto Rühle praktische Erfahrungen mit den Moskauer Kreml-Herren machte, die ihn von seinen Illusionen heilten. Die KAPD strebte damals noch die Mitgliedschaft in der vom Bolschewismus dominierten „Kommunistischen“ Internationale an. So schickte sie noch auf ihren Gründungsparteitag eine Delegation nach Moskau. Da aber die Verbindungen zwischen der KAPD und dieser Delegation abbrachen, schickte sie eine zweite Delegation aus Rühle und Merges als KAPD-Vertreter zum II. Weltkongress der „Kommunistischen“ Internationale. Die bolschewistische Parteibürokratie verlangte von Rühle und Merges eine absolute Kapitulation. So sollten die beiden sich bereits den Beschlüssen des II. Kongresses unterwerfen, noch bevor diese ihnen bekannt waren. Rühle und Merges lehnten diese Kapitulation ab und nahmen nicht am II. Weltkongress teil, was die KAPD-Zentrale später kritisierte.
Seine praktischen Erfahrungen mit der Moskauer Parteibürokratie führten bei Otto Rühle zu seinem geistigen Bruch mit dem Bolschewismus. So schrieb Rühle über seine Erfahrungen mit der staatskapitalistischen Parteidiktatur und der bolschewistischen Ideologie: „Revolution ist Parteisache. Staat ist Parteisache. Diktatur ist Parteisache. Partei ist Disziplin. Partei ist eiserne Disziplin. Partei ist Führerherrschaft. Partei ist straffster Zentralismus. Partei ist Militarismus. Partei ist straffster, eiserner, absoluter Militarismus.“ (Die Aktion, Jg. 10 (1920), Sp. 507.) Diese radikale Kritik Rühles an den Moskauer Kreml-Herren ging damals den meisten KAPD-Mitgliedern zu weit, die weiterhin die Mitgliedschaft in der „Kommunistischen“ Internationale anstrebten. Die parteifeindliche Strömung war natürlich dagegen. Der Konflikt zwischen der KAPD und der parteifeindlichen Strömung wurde schließlich so gelöst, dass Otto Rühle und die von ihm stark beeinflusste „ostsächsische Richtung“ von der Parteiführung Ende Oktober 1920 ausgeschlossen wurden. Daraufhin löste die in Dresden starke parteifeindliche Strömung die KAPD in der AAUD auf.
Die KAPD ließ sich dagegen im März 1921 von den Moskauer Kreml-Herren und der „K“PD in die staatskapitalistische Putschpolitik hineinziehen (siehe Kapitel I.13), wodurch auch die Dekadenz des radikalen Parteimarxismus als revolutionäre Theorie und Praxis offensichtlich wurde. Nach dem Scheitern dieser putschistischen Politik setzten Moskau und „K“PD wieder auf parlamentarischen und gewerkschaftlichen Sozialreformismus sowie Einheitsfronten mit der konterrevolutionären SPD. Die KAPD brach mit dem Lenin/Trotzki-Regime im Jahre 1921, ein Jahr nach dem parteifeindlichen Kommunismus. Doch anstatt zuzugeben, dass Rühle 1920 gegen die KAPD-Mehrheit recht hatte, machte die letztere den erstgenannten einen angeblich „zu frühen“ Bruch mit Moskau zum Vorwurf.
Paul Mattick brach erst 1921 mit der KAPD-Mehrheit mit dem Lenin/Trotzki-Regime. Wir wiederholen: dieser Bruch war schon im Jahre 1918 objektiv notwendig, aber es dauerte eine Weile bis er sich subjektiv durchsetzte. Doch was tat Mattick in späteren Jahren? Er ideologisierte den eher defensiven Bruch des radikalen Parteimarxismus mit Moskau. Auch innerhalb der „K“PD entwickelten sich im Verlauf der 1920er Jahre kremlfeindliche Strömungen, die schließlich mit der Sowjetunion brachen. Auch Matticks späterer Freund Karl Korsch gehörte zu jenen SozialrevolutionärInnen, die ab Mitte der 1920er Jahre konsequent den sowjetischen Staatskapitalismus bekämpften. Das ist natürlich zu begrüßen. Jedoch muss auch betont werden, dass Korschs Bruch mit dem Kreml relativ spät erfolgte. Doch Mattick ideologisierte die Verspätung und den verglichen mit dem parteifeindlichen Kommunismus verlangsamten Radikalisierungsprozess des radikalen Parteimarxismus: „Auch Korsch musste zu den durch die Russische Revolution aufgeworfenen Fragen und zu ihrem besonderen, nichtmarxistischen Charakter Stellung nehmen. Solange die Umstände es erlaubten, auf eine Revolution in Westeuropa zu hoffen – d.h. während der ,heroischen´ Periode des Kommunismus des Bürgerkriegs – ergriff er dafür Partei. Unter diesen Umständen sich gegen das bolschewistische Regime zu wenden hätte bedeutet, der Konterrevolution (nicht nur in Russland, sondern in aller Welt) zu folgen. Die Revolutionäre in Deutschland mussten die Russische Revolution notwendigerweise unterstützen, unter wie vielen Vorbehalten auch immer. Erst als die Bolschewisten selbst gegen die russischen und westeuropäischen Revolutionäre vorgingen – nicht zuletzt, um mit der kapitalistischen Welt ihren Frieden zu machen –, wurde es möglich, sich gegen das bolschewistische Regime zu kehren, ohne damit gleichzeitig der internationalen Konterrevolution in die Hände zu arbeiten.“ (Paul Mattick, Von der Notwendigkeit, den Marxismus mit Marx zu kritisieren. Ein Blick auf das Werk von Karl Korsch, in: Derselbe, Spontaneität und Organisation. Vier Versuche über praktische und theoretische Probleme der Arbeiterbewegung, Frankfurt am Main 1975, S. 80.)
Matticks Ausführungen stellen eine Ideologisierung des objektiv zu langsamen Bruches der SozialrevolutionärInnen mit dem konterrevolutionären staatskapitalistischen Regime in Moskau dar. Dieser Bruch war deshalb zu langsam, weil sich die SozialrevolutionärInnen von ihren eigenen probolschewistischen Illusionen befreien mussten. Und diese Illusionen hatten auch etwas mit den parteimarxistischen Traditionen zu tun, die sich als konterrevolutionär erwiesen. Mattick behauptete, dass es für RevolutionärInnen nicht möglich gewesen wäre, sich bereits in der Periode des BürgerInnen- und imperialistischen Interventionskrieges (1918-1921) in „Sowjet“-Russland sich von Moskau loszusagen. Doch dieser Krieg war objektiv einer zwischen Privat- und Staatskapitalismus. Es wäre also objektiv notwendig gewesen, sowohl die staatskapitalistische als auch die proprivatkapitalistische Seite von revolutionären Positionen aus zu bekämpfen. Diese objektiv notwendige Haltung war aber aufgrund der probolschewistischen Illusionen der westlichen radikalen MarxistInnen subjektiv nicht möglich. Natürlich war ein revolutionärer Sturz des bolschewistischen Lenin/Trotzki-Regimes objektiv unmöglich. Doch auch im Zweiten Weltkrieg war an einer revolutionären Zerschlagung der faschistischen und demokratischen Regimes sowie der Sowjetunion nicht zu denken – und doch bekämpften SozialrevolutionärInnen alle Seiten des imperialistischen Gemetzels. Mattick ideologisierte hier subjektive Schwäche der SozialrevolutionärInnen im Bruch mit der leninistischen Konterrevolution, anstatt objektive Notwendigkeiten auf den Punkt zu bringen. Indem er die objektive Notwendigkeit schon mit dem Lenin/Trotzki-Regime im BürgerInnen- und imperialistischen Interventionskrieg als Übergang in die Konterrevolution verunglimpfte, leistete er objektiv Propagandadienste für den Marxismus-Leninismus. Auch verwechselte Mattick die Russische Revolution mit der bolschewistischen Konterrevolution, die im Oktober 1917 begann und im März 1921 durch die Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes siegreich beendet wurde.
Felix Klopotek brachte im Jahre 2021 sein verdienstvolles Buch Rätekommunismus. Theorie – Geschichte heraus. Jedoch auch Klopotek war der Meinung, dass der Räteommunismus angeblich zu früh mit dem staatskapitalistischen Regime in Moskau gebrochen hatte. Das marxistisch-leninistische Käseblatt junge Welt druckte in der Ausgabe vom 29./30. Mai 2021 ein Interview mit Klopotek ab. Die Zeitung leugnete selbstverständlich in diesem Interview die leninistische Konterrevolution gegen die Räte (Sowjets): „Anfangs waren die Räte nichts als deutsche ,Sowjets´. Dennoch haben sie (die Rätekommunisten, Anmerkung von Nelke) sich vom Land der Räte abgewandt, weil es ihnen ein Land der Parteibürokratie geworden zu sein schien.“ („Schwellbrände sind Schwäche der sozialen Kämpfe weltweit.“ Ein Gespräch mit Felix Klopotek, in: junge Welt-Beilage faulheit & arbeit vom 29./30. Mai 2021, S. 2.)
Und Klopotek brachte es fertig, auf diesen leninistischen Ideologie-Müll so zu antworten: „Stopp – zwischen 1917 und 1920 bestand ein Unterschied! Den Bolschewiki war klar, dass sie Unterstützung nur von den Linksradikalen unter den Kadern der europäischen Arbeiterbewegung erwarten konnten. Es gab 1917 keine Rätekommunisten. Wer Kommunist war, bekannte sich selbstverständlich zum Roten Oktober und zu den Bolschewiki. Die Entfremdung setzte 1919 ein (die von Moskau gedeckte innerparteiliche Konterrevolution in der „K“PD gegen den antiparlamentarisch-gewerkschaftsfeindlichen Flügel, Anmerkung von Nelke), der Bruch wurde spätestens 1921 vollzogen (von der KAPD, Anmerkung von Nelke), vielleicht zu schnell, denn bis 1926 war nicht ausgemacht, dass die Sowjetunion einen nationalistisch-konterrevolutionären Weg einschlagen sollte.“
Herr Klopotek, müssen wir sie wirklich an die Errichtung einer staatskapitalistischen Wirtschaft im Sommer 1918, die beginnende Zerschlagung der Sowjets als Organe der klassenkämpferische Selbstorganisation des Proletariats kurz nach der bolschewistischen Machtübernahme und die konterrevolutionäre Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes im März 1921 durch das verdammte Lenin/Trotzki-Regime erinnern?! Alles lange vor 1926!
Neueste Kommentare