Neue Broschüre: Weltkapitalismus und globaler Klassenkampf
Unsere neue Broschüre „Weltkapitalismus und globaler Klassenkampf“ (ca. 139 Seiten) von Soziale Befreiung ist da. Die Broschüre könnt Ihr hier für 5-€ (inkl. Porto) über Onlinemarktplatz für Bücher booklooker.de oder direkt bei uns auch als E-Book bestellen.
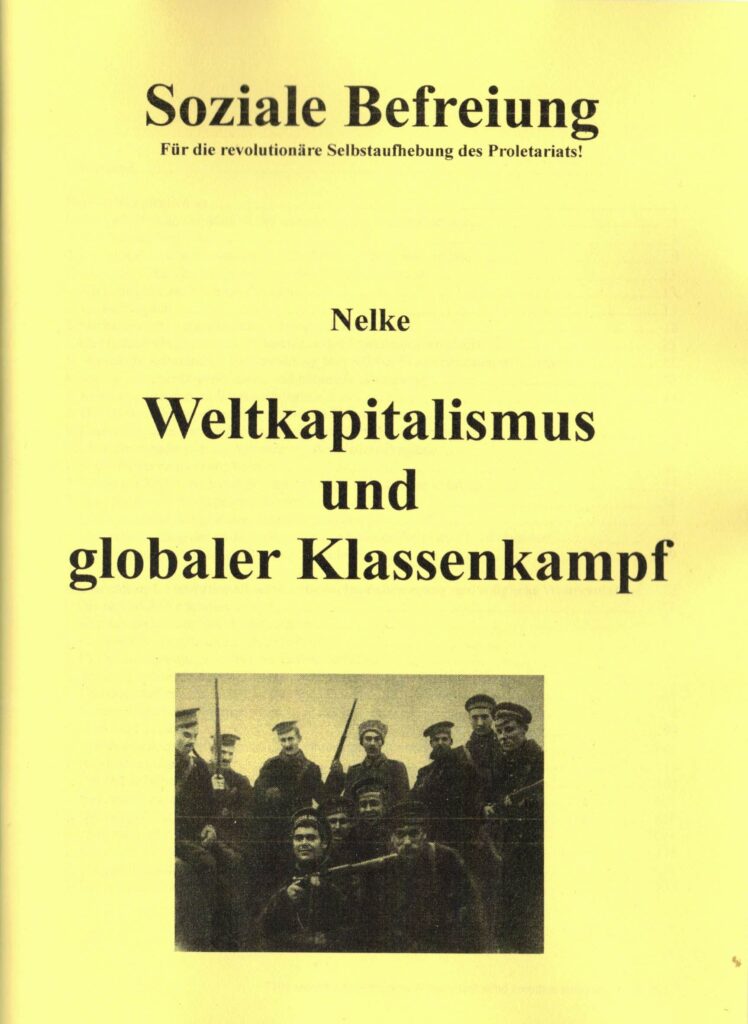
Einleitung
Der Weltkapitalismus
I. Der globale Kapitalismus ist die Interaktion der Nationalkapitale
1. Die Nationalkapitale
2. Die globale sozialökonomische Interaktion der Nationalkapitale
II. Die geschichtliche Herausbildung des Weltkapitalismus
1. Kleinbürgerliche Warenproduktion
2. Handelskapital
3. Vorindustrielle kapitalistische Warenproduktion
4. Der Industriekapitalismus als herrschendes Produktionsverhältnis
5. Die relativ selbständige Herausbildung bürgerlicher Nationalstaaten in Eurasien
6. Kapitalistischer Imperialismus und nationale „Befreiung“
7. Krieg und Frieden im Weltkapitalismus
8. Die Herausbildung eines internationalen Finanzsystems
9. Kapitalistisches Patriarchat und bürgerliche Frauenemanzipation
III. Die krisenhafte globale Vermehrung der Nationalkapitale
1. Kapitaluntervermehrungskrisen
2. Zyklische Krisen während der beschleunigten Kapitalvermehrung
3. Die strukturelle Profitproduktionskrise
4. Die Todeskrise des globalen Staatskapitalismus
5. Die Verschärfung der strukturellen Profitproduktionskrise im 21. Jahrhundert
6. Die permanente biosoziale Reproduktionskrise
Klassenkampf, institutionalisierte ArbeiterInnenbewegung und mögliche Weltrevolution
I. Der reproduktive Klassenkampf
1. Kapitalvermehrung und Klassenkampf
2. Konspirativ-illegaler Alltagsklassenkampf
3. Der Klassenkampf erwerbsloser ProletarierInnen
II. Institutionalisierte ArbeiterInnenbewegung und kommunistische Bewegung
1. Gewerkschaften
2. Vormarxistischer Kommunismus
3. Marx und Engels
4. Sozialdemokratie, Marxismus-Leninismus und Trotzkismus
5. Rätekommunismus
6. Der italienische „Linkskommunismus“
7. Der Anarchismus
8. Der antipolitische und gewerkschaftsfeindliche Kommunismus
III. Die mögliche soziale Weltrevolution
1. Die revolutionäre Situation
2. Die revolutionäre Klassenkampforganisation
3. Die revolutionäre Selbstaufhebung des Weltproletariats
Konspirativ-illegaler Alltagsklassenkampf
Die Lohnabhängigen sind auf den Arbeitsmärkten, auf denen sie ihre Arbeitskräfte vermieten, und auf den Konsumgütermärkten, auf denen sie die Waren und Dienstleistungen für ihre biosoziale Reproduktion kaufen und mieten, kleinbürgerliche Marktsubjekte. Diese Kleinbürgerlichkeit der ProletarierInnen nimmt mit der zunehmenden Fettschicht der Kapitalvermehrung und mit dem Anstieg der Löhne – auch als Folge des proletarischen Klassenkampfes – zu. Auch gilt: Je qualifizierter Arbeitskräfte sind, umso kleinbürgerlicher sind sie auch in der Regel.
Als kleinbürgerliche Marktsubjekte konkurrieren ProletarierInnen auch untereinander um Jobs und seltene Konsumgüter, zum Beispiel in den Städten um bezahlbare Mietwohnungen. Als Konkurrenzindividuen sind ProletarierInnen auch empfänglich gegenüber Chauvinismen wie Nationalismus, Rassismus und Sexismus. Nationalität, Hautfarbe, biologisches Geschlecht, soziale Geschlechterrolle und individuelle Geschlechtsidentität – alles wird zum Identitätskostüm im permanenten Kampf Aller gegen Alle.
Als Ausbeutungsobjekte produzieren die ProletarierInnen den Mehrwert für die Bourgeoisie und ihr eigenes Elend. Einigen Lohnabhängigen ist die Entfremdung und Ausbeutungsobjektivität durchaus bewusst. Andere blenden sie aus und kompensieren sie mit ProduzentInnenstolz und Unternehmenspatriotismus. Mensch ist auf die eigene Leistung und auf „die Firma“ stolz. Auch ProduzentInnenstolz und Unternehmenspatriotismus nehmen in der Regel mit der Qualifikation der Lohnabhängigen zu. Sie gehen oft mit einer sozialdarwinistischen Abgrenzung gegenüber den proletarischen Unterschichten einher
Innerhalb der Privathaushalte, in denen sich ProletarierInnen biosozial reproduzieren, sind ProletarierInnen ebenfalls kleinbürgerlich. Sowohl als Singles als auch als Beziehungs- und Familienmenschen. Auch in vielen proletarischen Kleinfamilien weltweit reproduziert sich das Patriarchat. Dieses kommt darin zum Ausdruck, dass die meisten innerfamiliären biosozialen Reproduktionstätigkeiten von den Frauen verrichtet werden. Auch nicht wenige proletarische Familien sind durch körperliche, psychisch-emotionale und sexualisierte Gewalt geprägt. Die meiste körperliche und sexualisierte Gewalt geht dabei von den Männern aus. Es gibt aber auch Frauen, die „ihren“ Männern durch Psychoterror zusetzen, oder sie gar körperlich misshandeln. Die bürgerliche Kleinfamilie ist oft ein asoziales Gewaltverhältnis.
Das sexuelle Elend auch von Lohnabhängigen kommt planetar in der Prostitution, einer Ware-Geld-Perversion, zum Ausdruck. Es sind hauptsächlich Männer, die gegen Geld Frauen oder andere Männer ficken. Lohnabhängige Frauen, die Callboys mieten, stellen eine Minderheitstendenz in der Prostitution dar.
Auch als StaatsbürgerInnen sind ProletarierInnen kleinbürgerlich. In den politischen Demokratien ermächtigen sie als Stimmvieh die BerufspolitikerInnen den Staat zu regieren oder systemloyal in ihm zu opponieren. BerufspolitikerInnen – egal ob regierend, opponierend, mittig, links oder rechts – sind grundsätzlich objektiv strukturelle Klassenfeinde des Proletariats. Sie leben vom politisch angeeigneten Mehrwert und organisieren gesamtgesellschaftlich-staatlich die kapitalistische Ausbeutung der Lohnarbeit. Indem ProletarierInnen in freien Wahlen – in denen weder die kapitalistischen Produktionsverhältnisse noch der Staat als politischer Gewaltapparat der Kapitalvermehrung zur Wahl steht – die BerufspolitikerInnen dazu ermächtigen, entweder den Staat zu regieren oder systemloyal in ihm zu opponieren, trinken sie noch den Kakao, durch den sie gezogen werden. Viele proletarische UnterschichtlerInnen spüren das instinktiv oder wissen dies ganz genau – auch Dank der materialistisch-dialektischen Gesellschaftsanalyse – und wählen deshalb nicht mehr.
Nur im und durch Klassenkampf ist das Weltproletariat tendenziell und potenziell revolutionär. Im globalen Klassenkampf entfaltet sich der Widerspruch zwischen den kleinbürgerlichen und den revolutionären Tendenzen des planetaren Proletariats. Nur im und durch Klassenkampf können sich die Lohnabhängigen selbst für ihre Interessen und Bedürfnisse und gegen den strukturellen Vermehrungszwang des Kapitals – durch den sie selbst zu verschwinden drohen – organisieren. Und dies geschieht bereits während des konspirativ-illegalen Alltagsklassenkampfes.
Durch innerbetriebliche Sabotage machen ProletarierInnen zum Beispiel das kaputt, was sie kaputt macht: Die kapitalistischen Produktionsmittel als Zerstörungsmittel der Bourgeoisie. Das tat zum Beispiel der Mähdrescherfahrer Tad in den USA: „Ich bekam Arbeit bei einer Firma, die im Sommer von Texas bis North Dakota der Weizenernte folgt. Die Mähdrescher, die wir benutzten, stammten aus einer Modellreihe und waren von International Harvester geliehen. Acht oder zehn von uns arbeiteten sich in breiter Front durch die Felder, testeten die neuen Modelle aus, schauten wie sie funktionierten.
Alle waren wir ziemlich jung, zwischen vierzehn und vierundzwanzig, und hätten uns eigentlich lieber verpisst, als zwölf Stunden am Tag auf diesen Kisten zu sitzen. Ein- oder zweimal die Woche hatten wir die Mähdrescher geschrottet, was bedeutet, dass wir so viel Korn geschnitten, bis die Motoren heiß liefen und die Zylinder überfordert waren. Wir legten zwei oder drei Maschinen lahm. Die wurden dann ausgemustert, und wir konnten das Feld verlassen. Vertreter von International Harvester kamen angerückt, zerlegten die Maschinen und versuchten herauszukriegen, was zum Teufel da eigentlich abging.
Wir haben es mit Absicht gemacht, weil wir so Pausen machen konnten. Wir hatten unseren Spaß an den Vertretern, mit ihren Krawatten und Klemmbrettern. Wir lachten uns ins Fäustchen. Die Firma war sehr betroffen, hatte sie doch einige Millionen Dollar investiert. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass wir irgendwas damit zu tun haben könnten. Wie die meisten Arbeitgeber hielten sie ihre Angestellten für dümmer, als sie sind. Ich denke, dass dies bei nicht gewerkschaftlich organisierter Gelegenheitsarbeit fast immer so abläuft. Sie gehen einfach davon aus, dass wir solche Tricks nicht anwenden. Bei diesem Job steckten alle Arbeiter unter einer Decke. Wir konnten in den Hotelräumen abhängen, während sie an den Mähdreschern rummachten.“ (Sabotage. ArbeiterInnen aus den USA erzählen ihre Version des alltäglichen Klassenkampfes, Berlin 1993, S. 46.)
Wir sehen, dass „die nicht gewerkschaftlich organisierten“ Mähdrescherfahrer im Kampf gegen das Kapital sehr gut organisiert waren. Sie wurden nicht von Gewerkschaftsbonzen desorganisiert, sondern organisierten sich selbst gegen das Kapital. Indem sie durch Sabotage an den kapitalistischen Produktionsmitteln ihre eigenen Bedürfnisse befriedigten, zeigten sie, dass die menschliche Arbeitskraft zwar Teil des produktiven Kapitals ist, sich aber gegen die unbegrenzte Kapitalisierung zu Wehr setzen kann. In diesem alltäglichen Klassenkampf der Mähdrescherfahrer können wir tendenziell den Kampf der Menschen gegen ihre eigene proletarische Existenz sehen, die bescheidenen Anfänge des sozialrevolutionären Selbstaufhebungsprozesses der ArbeiterInnenklasse.
Der proletarisierte Mensch, welcher diesen Kampf führt, hat sich oft noch nie mit revolutionärer Theorie beschäftigt. Er weiß oft nicht, dass er einen in Ansätzen revolutionären Kampf führt. Er tut es einfach, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Unser nachmarxistischer und nachanarchistischer Kommunismus ist ein theoretischer Ausdruck dieses alltäglichen Klassenkampfes. Durch unsere theoretische Wiederspiegelung machen wir das für das bürgerliche Auge Unsichtbare sichtbar, die unbewussten sozialrevolutionären Tendenzen bewusst. Dadurch nehmen wir praktisch und theoretisch bewusst am alltäglichen Klassenkampf teil.
Für sozialrevolutionäre ArbeiterInnen heißt es, das Bewusstsein am Arbeitsplatz zu revolutionieren zu helfen, wie weit das eben möglich ist. Und diese Möglichkeiten sind von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz verschieden. Diese Revolutionierung des Bewusstseins ist nicht nur durch Diskutieren zu vermitteln, sondern auch durch Initiative zur kollektiven Sabotage der alltäglichen Lohnarbeit, oder durch individuelle Sabotage Vorbild und Beispiel im praktischen Kampf gegen bürgerlichen Arbeitsethos und Leistungsideologie zu sein, so wie der US-amerikanische Computer-Techniker Dexter es beschreibt: „Ich sitze gerade an meinem Arbeitsplatz und tippe das in meinen MacIntosh. Ich könnte auch arbeiten. Wenigstens sieht es so aus, als würde ich arbeiten. Bei meinem Job ist es ganz selbstverständlich, dass ich was in den Computer eingebe. Wie auch immer, in den letzten vier Jahren, seit ich hier bin, habe ich höchstens ein Drittel meiner Zeit mit Arbeiten verbracht.
Mein Job besteht darin, alle möglichen technischen Texte, wie Gebrauchs- und Reparaturanweisungen sowie ähnliche technischen Beschreibungen zu formulieren und zu formatieren. Dafür muss ich regelmäßig mit Hardware- und Softwareingenieuren, Physikern und Marketingleuten sprechen. Die ganze Technik und auch die Leute finde ich faszinierend und außerdem gefällt mir das Feld technischer Kommunikation. Aber trotzdem finde ich immer schnell einen Weg, mich vor der Arbeit zu drücken. Ich habe mir eine ganze Reihe von Fähigkeiten des Desktop Publishing angeeignet, so dass ich die Arbeit von einer Woche in zwei Tagen erledigen kann. Die zwei Tage verteile ich natürlich über die Woche, d. h. ich schaffe das, was sie von mir erwarten, und manchmal auch ein bisschen mehr. Es zahlt sich halt aus, fleißig auszusehen.
Ich interessiere mich für alles, und dieses Interesse vervielfacht sich jeden Tag. Wäre ich allein und hätte genug Geld, würde ich eine Menge kreatives Zeug machen, und dabei alle möglichen Medien benutzen. Aber die Gesellschaft unterstützt solche kapriziösen und unverantwortlichen Denker wie mich natürlich nicht. Also muss ich diesen Mangel der Gesellschaft irgendwie umgehen und kann trotzdem meine Rechnungen bezahlen, indem ich meine Projekte während der Arbeit mache. In den letzten vier Jahren habe ich hier eine Novelle, Teile eines wissenschaftlichen Buches einer großen Verlagsgesellschaft, zwei Reiseerzählungen und zahllose kleinere Sachen geschrieben. Ich habe mir Computerdesign, -musik und -animation während der Arbeit angeeignet und sogar ein Computerspiel geschrieben. Insgesamt habe ich sicher tausend Arbeitsstunden damit zugebracht, meine Projekte zu machen, mit ganz anständiger Entlohnung.
Bei der Arbeit habe ich meistens mit Graphik oder Text zu tun. Das gilt aber auch für meine eigenen Projekte. Ich bin nicht besonders vorsichtig. Zuviel Vorsicht führt zu Paranoia, und Paranoia stört den schaffensfrohen Geist. Meine KollegInnen reagieren unterschiedlich. Manche glauben an die alte Arbeitsethik und meinen, du solltest die ganze Arbeitszeit für die Firma rackern. Andere hätten es auch gerne so wie ich gemacht, fanden aber nicht die Zeit dazu. Meine Chefs haben nie was gemerkt, und die KollegInnen tolerieren, was ich mache, und bewundern mich. Meist sind sie auch so mit ihren eigenen Sachen beschäftigt, dass sie sich nicht um meine kümmern. Die Chefs sind zufrieden, weil ich genauso viel oder sogar etwas mehr schaffe als verlangt.“ (Sabotage, a.a.O., S. 16.)
Dieses Beispiel geht über das Beispiel der Mähdrescherfahrer sowohl hinaus und gleichzeitig zurück. So widersprüchlich kann die Dialektik des alltäglichen Klassenkampfes sein. Der Computer-Techniker Dexter übt keine Sabotage an den Produktionsmitteln, sondern eignet sie sich produktiv an. In der Zeit, wo er seine Privatarbeiten am Computer erledigt, hört dieser praktisch auf Kapitaleigentum zu sein, auch wenn er das offiziell weiterhin bleibt. Dieses offizielle Belassen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse zeigt die reproduktive Grenze des alltäglichen Klassenkampfes an. Auch dass seine Aktion individuell erfolgt und nicht kollektiv, ist gegenüber den Mähdrescherfahrern ein Rückschritt, auch wenn er für einige seiner KollegInnen ein Vorbild darstellt und die individuelle Aktionsform durch den objektiven Arbeitsprozess bedingt ist.
Weiterhin ist festzuhalten, dass der Computer-Techniker Dexter im Gegensatz zu vielen anderen Lohnabhängigen sich in einer sehr günstigen Ausgangssituation befindet. Er muss keinen offensichtlichen Kampf gegen das Kapital führen, um seine Bedürfnisse nach privater Kreativität befriedigen zu können. Aber die offensichtliche kollektive Aneignung und Veränderung der Produktionsmittel ist der eigentliche sozialrevolutionäre Prozess.
In unseren Beispielen des alltäglichen Klassenkampfes hatten wir sowohl eine Form, bei der das Produktionsmittel informell und tendenziell für die eigene Bedürfnisbefriedigung angewendet wurde, als auch eine, in denen sie als Mittel der kapitalistischen Ausbeutung und Zerstörungsmittel der ArbeiterInnen zerstört wurden. Beide Formen sind auch in der bewussten sozialrevolutionären Aktion nötig: Aneignung der Produktionsmittel bei Abstreifung ihrer kapitalistischen Funktion (z. B. Computer), aber auch die Zerstörung von kapitalistischen Produktionsmitteln, für die es auch in einer klassenlosen Gesellschaft keine vernünftige Nutzung geben kann (zum Beispiel Kohle- und Atomkraftwerke).
Auch die Befreiung vom Kapitalfetisch, die Erkenntnis, dass die Trennung der ProduzentInnen von den Produktionsmitteln weder natürlich noch gottgewollt ist, sondern Ausdruck sozialer Verhältnisse, indem Produktionsmittel zu produktivem Kapital werden, was durch soziale Aktionen aber zu ändern ist, setzt sich schon tendenziell im alltäglichen Klassenkampf durch. Doch erst die bewusste sozialrevolutionäre Aktion und Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse kann den Kapitalfetisch für immer aufheben. Die tendenzielle Aufhebung des Kapitalfetischs kann mit einer teilweisen Verinnerlichung dieses Kapitalfetischs auch bei den klassenkämpferischen proletarischen Subjekten verbunden sein. Der Klassenkampf ist die Bedingung zur Überwindung des Kapitalfetisches, aber bedeutet eben nicht automatisch dessen Überwindung. Eine Arbeiterin kann während der Arbeitszeit unheimlich viel Pausen machen, für sich selbst massenhaft Dinge herstellen und nebenbei noch Betriebseigentum klauen wie ein Rabe, aber dennoch die kapitalistische Produktionsweise für unveränderlich halten. Das ist ein Ausdruck der objektiv-subjektiven Widersprüche, durch den der alltägliche Klassenkampf geprägt ist, und erst durch die Selbstbefreiung der proletarischen Subjekte in der sozialen Revolution gelöst werden können.
Sozialrevolutionäre Gruppen können die mögliche Radikalisierung des reproduktiven Klassenkampfes zur sozialen Revolution geistig und praktisch unterstützen, indem sie gegenüber den verschiedenen Spielarten des Sozialreformismus die Bedeutung von Aneignung und Sabotage für den proletarischen Widerstand gegen die kapitalistische Technokratie betonen. Dieser Klassenkampf ist gegen das kapitalistische Eigentum an Produktionsmitteln gerichtet und kann von Kapital, Staat und Gewerkschaftsbürokratie weder verrechtlicht noch institutionalisiert werden.
Im Jahre 2008 kam bei Sonderzahl in Wien das Buch Lexikon der Sabotage. Betrug, Verweigerung, Racheakte und Schabernack am Arbeitsplatz von Bernhard Halmer und Peter A. Krobath heraus, welches einen recht guten Einblick in den konspirativ-illegalen Alltagsklassenkampf gewährt. In ihm kommen die sabotageleistenden Lohnabhängigen selbst zu Wort. Zum Beispiel ein ehemaliges Zimmermädchen auf einem Luxusdampfer. Die Arbeit war so organisiert, dass immer ein Zimmermädchen eine Suite saubermachen sollte. Es war sogar verboten, sich untereinander zu helfen. Doch das ehemalige Zimmermädchen berichtete, wie sie mit einer Kollegin zusammen zu zweit die Suiten reinigten, wodurch sie viel schneller fertig wurden. Für dieses eigenmächtige Verändern der Arbeitsorganisation wurden sie bestraft. Aber sie nahmen die Strafen mit einem Lächeln hin und putzten weiter die Suiten zu zweit. Schließlich hörte die Chefin auf, die beiden zusammenarbeitenden Zimmermädchen zu bestrafen. Auch andere Zimmermädchen putzten schließlich die Suiten zu zweit. Dadurch hatte der Alltagsklassenkampf die Arbeitsorganisation verändert. (Bernhard Halmer, Peter A. Krobath, Lexikon der Sabotage. Betrug, Verweigerung, Racheakte und Schabernack am Arbeitsplatz, Sonderzahl, Wien 2008, S. 77-81.)
Die Form der illegal-konspirativen Änderung der Arbeitsorganisation durch das klassenkämpferische Proletariat, die zugleich die Produktion unterbricht, stellt das eigenmächtige Machen von Pausen dar. Im oben genannten Buch wird dafür ein besonders amüsantes Beispiel von einem Computerfachmann geschildert. Er hatte mit neun Kollegen den Auftrag für eine Supermarktkette, Kassen aus Südkorea umzubauen. Sie wurden nach der Arbeitszeit bezahlt und nicht kontrolliert. So wurde schon mal die Mittagspause auf drei Stunden ausgeweitet oder auch sonst mal die Arbeitszeit für drei Stunden unterbrochen. Während der Zeit hatten die Kollegen viel Spaß, zum Beispiel während sie mit Hubstablern um die Wette fuhren oder Mäuse fütterten. (Ebenda, S. 14.)
Die Änderung der Arbeitsorganisation durch den konspirativ-illegalen Alltagsklassenkampf des Proletariats kann nur die Ausbeutung und Entfremdung der kapitalistischen Produktionsweise abmildern, aber nicht grundsätzlich aufheben. Das kann nur die revolutionäre Selbstaufhebung des Proletariats.
Das Proletariat und das lohnabhängige KleinbürgerInnentum produzieren in der Regel Warenkapital, das dann auf den Märkten in Geld umgetauscht wird. Sie produzieren also in der Regel Geld, genauer: mehr Geld, als die kleinbürgerliche/kapitalistische Produktion von Waren und warenförmigen Dienstleistungen kostet. Viel wird auch im Kapitalismus für die Mülltonne produziert. Denn in diesem System zählen in der Regel nur zahlungsfähige Bedürfnisse als Nachfrage. Menschen, die bestimmte Bedürfnisse haben, aber nicht über das nötige Geld verfügen, um sich die Waren beziehungsweise warenförmigen Dienstleistungen zur Befriedigung dieser Bedürfnisse zu leisten, gehen leer aus. Gleichzeitig werden Waren auf dem Müll befördert, weil sich für sie keine KäuferInnen finden ließen. Auch der Müll als unverkäufliche Waren ist kapitalistisches Eigentum, dessen Aneignung illegal ist. Denn das unentgeltliche Verteilen von unverkäuflichen Waren würde die Preise senken. Deshalb gehört das Vernichten von unverkäuflichen Gütern, während gleichzeitig unzählige Bedürfnisse wegen Mangel an Geld unbefriedigt bleiben, unentrinnbar zur Logik der Warenproduktion. Besonders Lebensmittel werden weggeschmissen wegen der Hygienevorschriften, obwohl sie noch verzehr- und genießbar sind.
Die unentgeltliche Aneignung von Waren – egal ob von potenziell verkäuflichen oder von nicht mehr verkaufbaren „Müll“ – beziehungsweise die Sabotage am reibungslosen Verkauf der Waren innerhalb der Warenproduktion gehört zum illegalen Klassenkampf des Proletariats. Im Lexikon der Sabotage können wir beispielsweise lesen, wie eine Lagerarbeiterin, die sehr frustriert über den niedrigen Lohn, die Langeweile, das alltägliche Arbeitsklima aus Hetze, Stress und Unfreundlichkeiten durch die Chefs war, den Verkauf der Waren, Babysachen, sabotierte. Bei der Verpackung der Waren forderte sie die Kunden durch beigepackte Zettel auf, bei dieser Firma nicht weiter zu bestellen. (Ebenda, S. 21/22.)
Im oben erwähnten Buch Lexikon der Sabotage erzählt uns zum Beispiel eine „Vorregalbetreuerin“ aus einem Supermarkt, wie sie konspirativ-illegal sich den Lebensmittel-Müll, also unverkaufte Waren, für den familiären Verzehr aneignet. Während ihre Oma noch bei diesem Supermarkt arbeitete, konnte diese noch legal unverkaufte Lebensmittel mit nach Hause nehmen. Als sie selbst dort ausgebeutet wurde, war dies bereits verboten. Doch sie eignete sich den noch genießbaren „Müll“ der Warenproduktion konspirativ-illegal an, indem sie sich von einem Bekannten den General-Müllraumschlüssel der Müllabfuhr besorgte. Und sie beschädigte die Verpackung von Lebensmitteln, die sie sich selbst aneignen wollte. Wenn sie dann weggeschmissen wurden, griff sie zu. (Ebenda, S. 85-87.) Bei dieser Aktion wurde der Verkauf von Waren sabotiert. Güter konnten genossen werden, ohne dass dafür Geld bezahlt werden musste.
Im Buch kommt auch ein Kellner einer Catering-Firma zu Wort, dem das viele Wegschmeißen von noch verzehrbaren Lebensmitteln tierisch auf die Nerven ging. Einmal als wieder sehr viel weggeschmissen werden sollte, hörte er und seine KollegInnen nicht mehr auf ein anwesendes Chefchen, sondern verteilten die Lebensmittel, die eigentlich weggeworfen werden sollten, kostenlos am Bahnhof. (Ebenda, S. 37.) Das war eine solidarische Aktion, die schon nicht mehr konspirativ war, sondern offen die Anweisungen der Chefetage missachtete. Damit gaben sie ein Beispiel, wie die Warenproduktion grundsätzlich durch das klassenkämpferische Proletariat aufzuheben ist. Durch den Alltagsklassenkampf kann der Wahnsinn der kapitalistischen Warenproduktion nur abgemildert beziehungsweise sabotiert und dessen Gesetze für kurze Zeit teilweise aufgehoben werden. Nur die revolutionäre Aufhebung der Warenproduktion und die Herausbildung einer globalen unmittelbaren Bedarfsproduktion, zerschlägt endgültig die Ware-Geld-Beziehung.
Neueste Kommentare