Neue Broschüre: Antinationale Schriften IV
Unsere neue Broschüre „Antinationale Schriften IV“ (ca. 126 Seiten) von Soziale Befreiung ist da. Die Broschüre könnt Ihr hier für 5-€ (inkl. Porto) auch als E-Book über Onlinemarktplatz für Bücher booklooker.de oder direkt bei uns auch als E-Book bestellen .
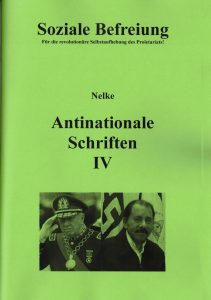
Inhalt
Einleitung
Lateinamerika im Fadenkreuz der Imperialismen
1. Spanischer Kolonialismus
2. Portugiesischer Kolonialismus
3. Französischer Kolonialismus
4. Britischer Imperialismus
5. US-Imperialismus
6. Deutscher/EU-Imperialismus
7. Sowjetischer/Russischer Imperialismus
8. Chinesischer Imperialismus
Der Kapitalismus in Lateinamerika
1. Das allgemeine Wesen des Kapitalismus
2. Der lateinamerikanische Nationalismus
3. Die nationalkapitalistische Entwicklung Lateinamerikas
5. Linker Sozialreformismus als Teil der kapitalistischen Elendsverwaltung
6. Die mögliche soziale Revolution in Lateinamerika
Rechts- und Linksreaktion in Lateinamerika
1. Zur politischen Konkurrenz zwischen lechts und rinks in Lateinamerika
2. Kuba
3. Chile
4. Nikaragua
5. Venezuela
6. Brasilien
7. Argentinien
Nikaragua
Ab 1893 regierte in Nikaragua die liberale Fraktion der herrschenden kapitalistischen Klasse. Kern war die Kaffee-Oligarchie, die vom Export dieses Genussmittels lebte. Im Jahre 1909 unterstützte der US-Imperialismus einen Aufstand von General Juan José Estrada, Gouverneur an der Miskitoküste, gegen Präsident Zelaya. Estrada wurde durch die Hilfe Washingtons neuer Präsident. 1911 trat Estrada zugunsten von Adolfo Díaz zurück. Der Konservative Díaz war noch eine offensichtlichere Marionette des US-Imperialismus. Bis zu seiner Machtübernahme war er Buchhalter eines US-Bergbauunternehmens, das nach Nikaragua Kapital exportierte, um den Profit zu importieren. Díaz nahm 1911 bei US-Banken Millionenkredite auf und überließ als Sicherheit der US-Regierung die direkte Kontrolle der nikaraguanischen Zolleinnahmen. Im Jahre 1912 unterstützte Washington seine nikaraguanische Marionette mit US-Marines gegen ein aufständisches Heer des bisherigen Kriegsministers Luís Mena. Die US-Marines landeten am 14. August 1912 in Nicaragua und besetzten die Städte Managua, Granada und León. Der US-Imperialismus behielt Nikaragua bis 1933 besetzt und unterstützte in der Regel die konservativen Regierungen gegen liberale Rebellen.
Die Liberalen und Konservativen führten von 1926 bis 1929 einen BürgerInnenkrieg als einen innerkapitalistischen Konkurrenzkampf um die Staatsmacht. Auch der General Augusto César Sandino gehörte am Anfang zur liberalen Fraktion des Kapitals. Nachdem der persönliche Abgesandte des US-Präsidenten Calvin Coolidge dem Anführer der Liberalen, General José María Moncada die Präsidentschaft versprochen hatte, erzwang er den Pakt von Espino Negro, in dem die Entwaffnung der Liberalen festgeschrieben wurde und der den BürgerInnenkrieg damit faktisch beendete. Doch Sandino führte weiterhin einen Guerilla-Krieg gegen die regierende Rechtsreaktion und den US-Imperialismus. Seit 1927 bauten die USA in Nikaragua die „Nationalgarde“ (Guardia Nacional de Nicaragua) auf, deren Oberbefehl sie ihrem Vertrauten, Anastasio Somoza García, zusprachen. Diese Washington hörige Nationalgarde übte gleichzeitig die Armee- und die Polizeifunktion aus. Zum Präsidenten wurde in einer von den USA durchgeführten Wahl der Schwiegeronkel Somozas, der Liberale Juan Bautista Sacasa, gewählt. Als der US-Imperialismus im Jahre 1933 seine Truppen aus Nikaragua abzog, legten auch Sandino und seine Guerilla die Waffen nieder und gingen mit Sacasa am 2. Februar 1933 ein Friedensabkommen ein. Doch Somozas Nationalgarde hielt die Friedensbestimmungen nicht ein und bekämpfte Sandinos Truppen weiterhin. Ein Jahr nach dem Friedensabkommen lud Somoza Sandino und seine engsten Offiziere zu einem Bankett, bei dem sie auf seine Veranlassung am 21. Februar 1934 ermordet wurden. 1937 putschte sich Somoza an die Macht. Diese behielt die Familie Somoza bis 1979.
1961 gründete sich in Nikaragua die kleinbürgerlich-radikale Guerilla-Organisation FSLN (SandinistInnen), die einen bewaffneten Kampf gegen das rechtsreaktionäre Somoza-Regime führte. Der bewaffnete Kampf um die Beherrschung des Staates ist vom Ziel her grundsätzlich sozialreaktionär, nur die Zerschlagung des Staates durch das sich selbst aufhebende Proletariat kann möglicherweise wirklich revolutionär sein. Die FSLN benutzte objektiv die bäuerliche Bevölkerung als Manövriermasse für einen innerkapitalistischen Konkurrenzkampf um die Staatsmacht. Dieser war durch die Krise des Somoza-Regime für die sandinistische FSLN erfolgreich. Am 19. Juli 1979 eroberte sie die Staatsmacht. Daniel Ortega wurde die regierende Charaktermaske Nikaraguas.
Das sandinistische Regime (1979-19090) verkörperte eine staatsinterventionistische und -kapitalistische Tendenz im Rahmen des Privatkapitalismus – und war somit absolut sozialreaktionär. Der staatskapitalistische Sektor erzeugte Mitte der 1980er Jahre 40 Prozent des Bruttosozialproduktes. Noch heute wird das sandinistische Regime von der internationalen Linksreaktion „kritisch“ oder kritiklos abgefeiert. Die Zeitschrift Wildcat – die dafür bekannt ist, zwischen linksreaktionären und sozialrevolutionären Positionen hilflos hin und her zu schwanken – schrieb über das erste sandinistische Regime: „Neben revolutionärer Rhetorik und Symbolik sah das soziale Maximalprogramm Agrarreform, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung, vorsichtige Verstaatlichung der Bodenschätze sowie Demokratisierung vor. In einem Land mit der Geschichte Nikaraguas durchaus radikale Vorhaben.“ Doch die von Wildcat hier hochgelobte „Radikalität“ bewegte sich im Rahmen des Privatkapitalismus. Innerbürgerlicher „Fortschritt“ ist jedoch immer im Rahmen der kapitalistischen Zivilisationsbarbarei gefangen und deshalb grundsätzlich sozialreaktionär. Auch das Regime der SandinistInnen war ein struktureller Klassenfeind des Weltproletariats.
Doch im Gegensatz zu völlig reaktionäre „AntiimperialistInnen“, die die Maßnahmen des sandinistischen Regimes gegen das Proletariat entweder leugnen oder mit der imperialistischen Aggression der USA ab 1981 (siehe Kapitel 5 unseres Textes Lateinamerika im Fadenkreuz der Imperialismen) rechtfertigen, kritisiert Wildcat diese – wenn auch nicht mit der notwendigen Schärfe und Konsequenz: „Bereits vor der Phase des offenen konterrevolutionären Kriegs niedriger Intensität (finanziert und bewaffnet aus den USA über ihren Stützpunkt Honduras) gegen ,die Revolution‘, also vor 1981 verteidigte die FSLN häufig auf repressive Weise ihren Alleinanspruch auf Absicherung ,des Prozesses‘: Arbeiterstreiks in einem großen Zuckerbetrieb wurden niedergeschlagen, spontane Landbesetzungen rückgängig gemacht, Gewerkschaftswahlen manipuliert, eine linke Zeitung sowie die dazugehörige Organisation verboten, die Abtreibung aus Rücksicht auf die katholische Kirche geächtet.
Die offizielle Losung für das Jahr 1980 lautete düster: ,Arbeit, Disziplin, Produktivität‘. Das 60-köpfige Zentralkomitee der Partei, die sandinistische Versammlung, wurde ernannt. Das Neunergremium der FSLN-Führung (…) blieb unantastbar, gottgleich. Massenmobilisierungen dienten zur öffentlichen Absegnung bereits gefällter Entscheidungen. Es herrschte die Vorstellung, möglichst alles zentralisiert zu kontrollieren. Das mündete in undurchschaubare bürokratische Strukturen, die Eigeninitiative abwürgten. Mit dem Krieg der Contra bekam diese Praxis eine Legitimation, die nicht mehr kritisierbar war.
Nach einem neunjährigen Abnutzungskrieg verlor die FSLN – für sie selber völlig überraschend die Präsidentschaftswahlen 1990. Zwei Faktoren waren ausschlaggebend: Die vielen Toten, die entgegen der Propaganda täglich in den Armenvierteln Managuas beerdigt werden mussten, sowie die – von der FSLN bis zuletzt geleugnete – Beteiligung eines Teils der Landbevölkerung an konterrevolutionären Aktivitäten im Norden.“ (Von der Fokus-Theorie zum Volkskrieg langer Dauer, in: Wildcat Nr. 103 vom Frühjahr 2019, S. 65.)
Dieser Artikel verbreitet nicht die sozialrevolutionäre Schlussfolgerung, dass jeder Staat und damit auch jede Regierung nur kapitalistisch-sozialreaktionär sein kann. Er seziert lediglich an den Symptomen der regierenden strukturellen Linksreaktion in Nikaragua. Die Kritik am Sandinismus fällt durch eine schwammige Wortwahl auf. So wird die bewaffnete Rechtsreaktion „Konterrevolution“ genannt. Konterrevolution ist die Reaktion gegen eine revolutionäre Kraft. Aber der Sandinismus verkörperte in der Wirklichkeit nicht die soziale Revolution, sondern er gehörte zur linken Fraktion des Kapitals. Die Menschen, die im Konflikt zwischen Rechts- und Linksreaktion beziehungsweise zwischen US-Imperialismus und nikaraguanischen Nationalismus starben, waren die Opfer eines innerkapitalistischen politischen Konkurrenzkampfes. Wildcat fehlt es an revolutionärer Konsequenz, dies eindeutig so zu sehen und so zu sagen.
Ab 1990 wurde also der Sandinismus von der regierenden Rechtsreaktion abgelöst. Diese war das Wahlbündnis UNO (Unión Nacional Opositora). Die UNO verhinderte einen BürgerInnenkrieg mit den linksreaktionären SandinistInnen, indem sie Humberto Ortega (den Bruder von Daniel Ortega) zum obersten Befehlshaber der Streitkräfte machte. Auch sonst hatte die sandinistische FSLN wichtige Funktionen in den rechtsreaktionären Regierungen ab 1990. Mensch kann von einer regelrechten Kumpanei des Sandinismus mit der regierenden Rechtsreaktion sprechen. Diese führten einen neoliberalen Klassenkampf von oben gegen das Proletariat. Die kapitalistische Privatwirtschaft wurde durch Entstaatlichungen ab 1996 gestärkt, die Preise für die Grundnahrungsmittel stiegen, die Agrarreform wurde rückgängig gemacht und Kindergärten geschlossen. Die Folge dieses brutalen Klassenkrieges von oben war die Zunahme des Elends. Es stiegen die Arbeitslosigkeit, die Analphabetenrate und die Kindersterblichkeit.
Unter der Präsidentschaft Bolaños (2001-2005) beendete die regierende Rechtsreaktion die Kooperation mit der FSLN, die wieder einen auf Opposition machte – bis sie abermals im Jahre 2005 innerhalb des Wahlrummels die Staatsmacht eroberte. Daniel Ortega wurde wieder regierende Charaktermaske Nikaraguas, in dieser Funktion wurde er auch vom demokratischen Wahlzirkus 2011 und 2016 bestätigt. Um sich als soziale Wohltäterin aufzuspielen und dies in Stimmzettel für sich umzuwandeln, milderte das Ortega-Regime zuerst etwas das kapitalistische Elend – was aber selbstverständlich erhalten blieb. So wurde ein Null-Hunger-Programm aufgelegt, durch das Schulkinder unentgeltlich täglich eine Mahlzeit bekamen. Außerdem wurden Gesundheitsvorsorge und Bildung wieder kostenlos. Die regierende Linksreaktion spielte sich auch als Wohltäterin der kleinen und mittleren BäuerInnen sowie UnternehmerInnen auf, die Land und Kredite zu niedrigen Zinsen bekamen, aber als Gegenleistung in die FSLN eintreten mussten.
Im April 2018 ging das Ortega-Regime im Klassenkampf von oben in die Offensive, indem es die Rente um fünf Prozent kürzte. Daraufhin entwickelte sich eine Protestbewegung. Die regierende Linksreaktion ging mit tödlicher bewaffneter Gewalt gegen die Proteste vor, die auch nicht abflammten als das Ortega-Regime die Rentenreform zurücknahm. Im Juli 2018 gelang es dem Regime nach über 200 Toten wieder für eine Friedhofsruhe zu sorgen. Der Fakt, dass dieser Protest von der Rechtsopposition und dem westlichen Menschenrechts-Imperialismus in ihrem politischen Konkurrenzkampf gegen das Ortega-Regime instrumentalisiert wurde, musste für den reaktionärsten Teil des linksnationalen „Antiimperialismus“ herhalten, um die Repression der bluttriefenden FSLN zu unterstützen. Widerliches linksreaktionäres Pack!
….
Im Kapitel 6 unserer Schrift Lateinamerika im Fadenkreuz der Imperialismen haben wir bei der Schilderung des imperialistischen Druckes der damals sozialdemokratisch regierten BRD auf das erste sandinistische Regime (1979-1990) bereits ein ehemaliges Mitglied der Nikaragua-Solidaritätsbewegung zitiert – versehen mit einigen kritischen Anmerkungen. Über den von uns zitierten Autoren heißt es in Wildcat: „Der Autor war zwischen 1982 und 1990 in der Nikaragua-Solidaritätsbewegung aktiv und vertrat lange die Linie, jede öffentliche Kritik an der FSLN spiele ,dem Imperialismus‘ in die Hände.“ (Rückblicke mit Ecken und Kanten, a.a.O., S. 64.) Wenn Menschen sich radikalisieren und Irrtümer überwinden, ist das immer toll. Auch der Autor dieser Zeilen, Nelke, war in den 1990er Jahren Mitglied in sozialdemokratischen Organisationen (PDS, SAV) – gehörte also objektiv zum proletarischen Schwanz der linken Fraktion des Kapitals. Der Selbstkritik des ehemaligen Aktivisten der Nikaragua-Solidaritätsbewegung fehlt es allerdings an sozialrevolutionärer Konsequenz. So können wir bei ihm nirgendwo lesen, dass die „Solidarität“ mit einem bürgerlich-kapitalistischen Staat wie dem sandinistischen Nikaragua grundsätzlich sozialreaktionär war. Auch wird von ihm nicht reflektiert, dass die „Nikaragua-Solidaritätsbewegung“ der 1980er Jahre objektiv eine Schwanzfeder der linken Fraktion des Kapitals war.
Trotz dieser prinzipiellen Kritik halten wir die Ausführungen des ehemaligen Mitglieds der Nikaragua-Solidaritätsbewegung für sehr interessant, so dass wir Auszüge davon hier widergeben wollen: „Die (Nikaragua-) Solidaritätsbewegung war auch ein Ausdruck der Abwendung von den Verhältnissen in der BRD, wo die Massen als integriert und korrumpiert galten. Die eigenen (aufgegebenen) Revolutionshoffnungen wurden einem Ministaat in 10 000 km Entfernung aufgebürdet. Durch den Mythos des bewaffneten Kampfs, der als Gipfel der Radikalität galt, konnte in Nikaragua ein linkssozialdemokratisches Programm als ,soziale Revolution‘ gelten. (…)
Der Aufbau des neuen Staates in Nikaragua wurde von der Solidaritätsbewegung ohne offene Kritik mitgetragen. Obwohl sich die Solidaritätsbewegten (im Vergleich zu Kuba) relativ unkontrolliert im Land bewegen konnten, ignorierten sie jede FSLN-unabhängige oder gegen diese gerichtete Mobilisierung. Es gab lange den stillschweigenden Konsens, über unangenehme Themen öffentlich nicht zu reden, auch wenn z. B. die Widerstände gegen die Agrarreform unübersehbar waren (…). Der Übergang von einem von außen angeheizten und organisierten gegenrevolutionären Krieg zu einer Art ,Bürgerkrieg‘ in einigen ländlichen Gebieten wurde verdrängt.
Die internationale Solidaritätsbewegung sollte idealtypisch befehlsempfangende Unterorganisation der FSLN im jeweiligen Land sein. Das funktionierte in Italien und Frankreich mit ihren starken KPs recht gut. In der BRD war die ,apparatunabhängige‘ Solidarität stark. Versuche der FSLN, mit ihrem umfassenden Kontrollanspruch alle Gruppen einem zentralistisch-hierarchischen Modell zu unterwerfen, schlugen fehl. (…) Die unabhängige Bewegung in der BRD wollte eine eigenständige politische Kraft bleiben. Aber sie unterstützte die FSLN insofern weitgehend, als sie oft geschwiegen oder nur in Hinterzimmergesprächen Kritik geübt hat. Das galt auch, als Mitte der 1980er Gelder aus der internationalen Kampagne ,Nikaragua muss überleben‘ für die Renovierung der nikaraguanischen Botschaft benutzt wurden. (…)
Die Arbeitsbrigaden konnten diese Muster etwas aufbrechen. Vor allem als Propagandainstrument gegen den Contra-Krieg konzipiert, hatten sie einen unvorhergesehenen Nebeneffekt. Die BrigadistInnen sollten in der BRD von den Greueltaten der Contra und den daraus resultierenden schwierigen Lebensbedingungen auf dem Land berichten. Sie wurden aber vor allem Zeugen der Realität: Entscheidungsstrukturen, Hierarchien, Verhalten der überwiegend jungen städtischen Kader der FSLN etc. Hier wurde die romantische Vorstellung vom ,neuen Menschen‘ bei vielen Solidaritätsbewegten gründlich entzaubert.
Die Wahlniederlage der FSLN im Februar 1990 war ein Schock für die Solidaritätsbewegung. Der von der SPD organisierte Wahlkampf unter der Parole ,todo será mejor‘ (,alles wird besser‘) hatte zwar intern Kritik ausgelöst, und die Konzentration auf FSLN-Chef Daniel Ortega (der als Macho-Figur ,el gallo‘ in jedes nikaraguanische Dorf einritt und dort die Miss Sandinista wählen ließ) führte zu Protesten. Aber auch die ,unabhängige‘ Strömung der Solidaritätsbewegung hatte den Wahlkampf der Regierungspartei FSLN unterstützt, da nur dadurch ,die Weiterentwicklung der Revolution‘ unterstützt werden könne.
In der Zeit zwischen Wahlen und Regierungsübernahme der Rechtsopposition verteilte die FSLN Grundstücke, Häuser, Autos an verdiente Parteimitglieder, damit die ,Somozisten‘ nicht zu viel in die Hände fallen konnte, so die spätere Legitimation. Das Volk ging dabei leer aus.“ (Rückblicke mit Ecken und Kanten, a.a.O., S. 63/64.)
Die Verwendung des schwammigen und klassenneutralen Begriffs des „Volkes“ – das Berufungsobjekt aller Rechts- und LinksnationalistInnen schlechthin! – durch den ehemaligen Aktivisten der „Nikaragua-Solidaritätsbewegung“ weist wie vieles andere auf seine mangelnde vollständige Abnabelung vom linksreaktionären „Antiimperialismus“ hin.
5. Venezuela
Über das in Venezuela seit 1998 existierende linksreaktionäre Regime in Venezuela wurde in dem Kapitel 5 der Schrift Lateinamerika im Fadenkreuz der Imperialismen schon alles Wesentliche geschrieben: Es versuchte, durch Ölexport finanziert, ein wenig Sozialstaatspolitik als kapitalistische Elendsverwaltung zu betreiben, um das Proletariat zu befrieden. Begleitet war diese bürgerliche Politik mit übler demagogischer „antiimperialistischer“ und „antikapitalistischer“ Rhetorik. Über diese Sozialstaatspolitik schrieben die italienischen LinkskommunistInnen von Battaglia Comunista im Jahre 2017: „Zu einem wirklichen sozialen Fortschritt, den das Chavez-Regime angeblich ausgezeichnet haben soll, ist es nie gekommen. Der Kampf gegen den Analphabetismus, die Eindämmung der Gewalt in den Großstädten und die Verbesserung der miserablen Lebensbedingungen in den Favelas sind größtenteils Projekte auf dem Papier geblieben. Das Wenige was getan wurde, zielte lediglich darauf ab, sich eine soziale Basis unter den Millionen verzweifelter Menschen zu verschaffen, die auf die falsche Hoffnung setzten, dass das Programm von Chavez zwar nicht den Himmel auf Erden, aber zumindest ein wenig Verbesserung bewirken könnte. Das Programm, was zu seiner Wiederwahl führte, musste zwar den weitverbreiteten Illusionen einige Tropfen aus den Öl-Einnahmen zugestehen, doch der Großteil floss in den Regierungsapparat, wo sich eine neue Staatsbourgeoisie hemmungslos bereicherte und die Finanzspekulation wie in jedem anderen kapitalistischen Land ihre Blüten trieb. Der einzige Unterschied bestand darin, dass all das als ,sozialistisches Experiment‘ ausgegeben wurde. Als der Rohölpreis drastisch einbrach, lagen die Mängel und Schwächen des Regimes hinsichtlich des Bildungssektors, der Gesundheitsversorgung und dem Kampf gegen Armut zutage. Laut einem Bericht der Caritas (…) gibt es in Venezuela Hinweise auf eine chronische Unterernährung von Kindern. In einigen Regionen habe diese nach internationalen Standards ein kritisches Niveau erreicht: ,Es gibt gefährliche und irreversible Überlebensstrategien in wirtschaftlicher, sozialer und gesundheitlicher Hinsicht, und was besonders besorgniserregend ist, ist der Verzehr von Nahrungsmitteln, die auf der Straße aufgelesen werden.‘ (http://www.caritas.org/2017/05/children-face-hunger-crisis-in-venezuela-as-malnutrition-soars/) Nach einer Umfrage im venezolanischen Bundesstaat Miranda haben 86% der Kinder Angst, nicht genug zu essen zu haben. 50% von ihnen mussten hungrig zu Bett gehen, da nichts zum Essen im Hause war. Die Regionaldirektorin von Amnesty International, Erika Guevara, berichtete im Juni 2016: ,Das Krankenhaus ‚JM de los Rios‘ in Caracas war der Stolz des Landes und ein Vorbild für Pädiatrische Pflege. Heute ist es ein tragisches Symbol für die Krise in dem lateinamerikanischen Land. Die Hälfte des großen Gebäudes ist zusammengebrochen, an den Wänden blättert die Farbe ab, die Fußböden sind überflutet und die Zimmer in so schlechten Zustand, dass sie nicht mehr genutzt werden können. Das Krankenhaus ist nur noch zur Hälfte in Betrieb, hunderte Kinder werden behandelt. Aber aufgrund des Fehlens dringend benötigter Medikamente und grundlegender medizinischer Versorgung haben ihre Mütter schon aufgegeben nach ihnen zu fragen. Der Mangel an medizinischer Versorgung ist nur ein Aspekt der tiefen humanitären Krise, die das Land seit drei Jahren im Griff hält. Diese Tragödie hätte verhindert werden können. Jahrelang verfügte das Land über eine der weltweit größten Ölvorkommen. Aber der plötzliche Fall des Ölpreises hat eine Wirklichkeit offenbart, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: Die venezolanische Regierung hat vergessen, in die Infrastruktur zu investieren. Ein Land, dass bisher von Nahrungsmitteln bis hin zu Medikamenten alles importierte, kann sich nicht einmal mehr Antibiotika leisten. Die Folgen sind katastrophal. Nach venezolanischen Berechnungen fehlen dem Land 80% der Lebensmittel und Medikamente, die es braucht. In Venezuela gibt es eine der höchsten Sterberaten in der Welt. Ärzte die mit so einem Mangel konfrontiert sind, müssen improvisieren um Leben zu retten und unter Bedingungen arbeiten, die einem Kriegsgebiet gleichen. Private Krankenhäuser stehen bei der Beschaffung dringendst benötigten Medikamente vor ähnlichen Problemen. Das Leitungspersonal der Geburtsklinik ,Conception Palacios‘, einer der größten des Landes, erzählten uns, dass im ersten Quartal 2016, 101 Neugeborene gestorben sind. Das sind doppelt so viele wie in der gleichen Periode im vergangenen Jahr. Im gleichen Krankenhaus sind seit Anfang 2016 ca. 100 Frauen bei der Geburt gestorben. Das Fehlen einer offiziellen Statistik zeigt, dass die Regierung von Nicolas Maduro, die internationale Hilfsleitungen ablehnt, ihre innenpolitischen Gegner für die schrecklichen Zustände verantwortlich machen möchte.‘ (http://aristeguinoticias.com/2206/mundo/venezuela-en-cuidados-intensivos-articulo-de-erika-guevara-rosas/)
In der Reportage ,Las Voces del Haber‘ (Stimmen des Hungers) des venezolanischen Journalisten Fernando Girón sind Szenen zu sehen, in denen Kinder mit Raubvögeln um ein paar Schweineknochen kämpfen, die ein Metzger weggeworfen hatte. ,Der Hunger in Venezuela ist kein Spaß. Der Mangel an Nahrungsmitteln hat undenkbare Grenzen überschritten und Menschen brechen bei dem Versuch ihren Familien etwas zu Essen zu besorgen vor Erschöpfung regelrecht zusammen.‘ (http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/las-voces-del-hambre-reportaje-que-muestra-crisis-venezolana_83027 )
Unter dem Chavez-Regime konnte dank der Öl-Einnahmen in relativ hohen Maße Kapital akkumuliert werden, allerdings ohne selbst eine mittelmäßige industrielle Entwicklung voranzubringen. Stattdessen wurden einige Krümel den ,kleinen Leuten‘ gegeben, um sich ihre Wahlstimmen zu sichern, während die Öleinnahmen die mit dem Regime verbundene ,Staatsnomenklatura‘ aus hohen Offizieren, Bankern, Managern und allerlei Spekulanten bereicherte. In der Zeitspanne von 2003 bis 2013 flossen 180 Milliarden Dollar aus Venezuela in die Finanzspekulation ,made in USA‘.
Dieser Kapitalflucht lag der Skandal mit strukturierten Anleihen zugrunde, die wiederum Ausdruck der korrupten Verwaltung der Öl-Einnahmen war, und von staatlichen Stellen gedeckt wurde, da es sich aus ihrer Sicht um einen ganz normalen Vorgang handelte. Auch in der öffentlichen Meinung fand dieser Skandal milde Beurteilung und wurde als Einzelfall abgetan, da schließlich auch niemand verurteilt wurde. Ebenso wenig wurde der gesellschaftliche Schaden dieser vom Staat als Ganzes ausgelösten Spekulationsbewegung jemals ermittelt.“ (http://gis.blogsport.de/2017/06/30/venezuela-der-bolivarische-weg-zum-sozialismus-in-der-sackgasse/#more-442)
Das Sinken des Ölpreises hat der chavistischen Kapitalvermehrungsstrategie und die Befriedung der Armen das Genick gebrochen. Doch wie das global generell der Fall ist, begünstigte auch der Niedergang des linksreaktionären Regimes in Venezuela bei der weltweiten Schwäche antipolitisch-sozialrevolutionärer Strömungen die rechtsreaktionäre politische Opposition in diesem Staat. So konnte die rechte Opposition bei den Parlamentswahlen am 6. Dezember 2015 eine Zweidrittelmehrheit erringen. Nun etablierte sich eine Doppelherrschaft. Während die ChavistInnen weiterhin den Staatsapparat beherrschten, dominierte die rechte politische Opposition das Parlament. Doch der Oberste Gerichtshof Venezuelas erkannte die Wahl von vier Abgeordneten – von denen drei der rechtsreaktionären Opposition angehörten – nicht an. Dadurch ging die Zweidrittelmehrheit der rechten politischen Opposition im Parlament wieder flöten.
Selbstverständlich versuchte die rechte politische Opposition diesen Sieg bei den Parlamentswahlen zu nutzen, um das chavistische Regime zu stürzen. Die Wortführer der rechten politischen Opposition wie Freddy Guevara von der Partei Voluntad Popular (Volkswille) forderten monatelang die sofortige Durchführung von vorgezogenen Präsidentschaftswahlen. Das von der politischen Rechtsreaktion beherrschte Parlament wurde jedoch vom linksreaktionären Regime weitgehend umgangen, indem das regierungstreue Oberste Gericht im Oktober 2016 beschloss, dass der Staatsapparat sein Budget per Dekret am Parlament vorbei beschließen könne. Am 9. Januar 2017 erklärte das rechte Parlament den linken Präsidenten Maduro für abgesetzt. Daraufhin entzog das linksreaktionäre Oberste Gericht am 29. März 2017 allen ParlamentarierInnen die Immunität sowie dem Parlament alle Kompetenzen
Das linksreaktionäre Regime entmachtete das von der rechtsreaktionären politischen Opposition beherrschte Parlament, in dem es dieses weitgehend durch die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung am 30. Juli 2017 ausschaltete. Diese Wahl zu einer verfassungsgebenden Versammlung wurde wiederum von der rechten politischen Opposition boykottiert. Auch der westliche US- und EU-Imperialismus bekämpften diese neue Institution des Chavismus. Kaum war die verfassungsgebende Versammlung gewählt, versetzte sie der rechtsreaktionären politischen Konkurrenz auch schon einen Tritt gegen das Schienenbei. Während das chavistische Regime die Regionalwahlen über Monate immer weiter verschob, verlegte die verfassungsgebende Versammlung sie am 12. August vom 10. Dezember 2017 auf Oktober dieses Jahres vor. Damit sollten die Teile der rechten politischen Opposition geschwächt werden, die an den Regionalwahlen teilnehmen wollten. Auf diese Weise sollte ihnen die Vorbereitungszeit auf die Regionalwahlen gekürzt werden.
Die Doppelherrschaft entlud sich in einem BürgerInnenkrieg zwischen Rechts- und Linksreaktion. Die Fußtruppen der rechtsreaktionären Straßenbewegung gegen das chavistische Regime besteht überwiegend aus StudentInnen und Angehörigen des KleinbürgerInnentums. Neben gewaltsamen Straßendemonstrationen griffen Teile der Rechtsreaktion die linksreaktionäre Regierung auch offen militärisch an. So drangen am 6. August 2017 rund 20 Bewaffnete in den Stützpunkt Paramacay nahe der Stadt Valencia westlich von Caracas ein, der Angriff konnte jedoch vom linksreaktionären Regime zurückgeschlagen werden. Während des Angriffes kursierte im Internet ein Video, in dem mehrere Uniformierte erklärten, dass sie Venezuela zur Demokratie zurückführen wollten. Sie riefen auch zur landesweiten Erhebung gegen Präsident Maduro auf. Dies wäre kein Staatsstreich, sondern eine bürgerliche und militärische Aktion zur Wiederherstellung der Verfassungsordnung, behauptete ein Mann, der sich als Exoffizier der Nationalgarden vorstellte.
Der Chef der von der rechten Opposition beherrschten Nationalversammlung, Juan Guaidó, ernannte sich selbst am 23 Januar 2019 zum Übergangspräsidenten Venezuelas. Die Rechtsopposition ging also gegenüber der regierenden Konkurrenz zu einer putschistischen Politik über, die auch noch sehr kläglich daherkam. Maduro blieb real an der Macht. Am 30. April 2019 versuchte in Venezuela die Rechtsreaktion durch einen Militärputsch an die politische Macht zu gelangen, scheiterte jedoch kläglich.
Wie wir bereits im Kapitel 5 des Textes Rechts- und Linksreaktion in Lateinamerika geschrieben haben, spielt der US-Verbündete Kolumbien eine große Rolle als Schutzmacht der venezolanischen rechten Opposition. Als Teile der ehemaligen FARC-Guerilla im Spätsommer 2019 wieder den bewaffneten Kampf aufnahmen (siehe Kapitel 1 dieses Textes), warf die regierende Rechtsreaktion in Kolumbien ihrer linken Konkurrenz in Venezuela vor, dies zu unterstützen. Kolumbien begann Anfang September 2019 einen Propagandakrieg gegen Venezuela. Der kolumbianische Schwanz versuchte mit dem US-amerikanischen Hund zu wedeln und forderte Washington auf, Venezuela auf die Liste der Staaten zu setzen, die den Terrorismus unterstützen. Nach der Offensive Kolumbiens im Propaganda-Krieg, rasselte das linksreaktionäre venezolanische Regime mit dem Säbel und gab Anfang September 2019 die zweithöchste Alarmstufe Orange für die an der Grenze zum konkurrierenden Nachbarstaat stationierten Truppen aus. Daraufhin erklärte die vom US-Imperialismus dominierte „Organisation Amerikanischer Staaten“ den militärischen Beistand gegen Venezuela. Mitte September 2019 tauchten dann Fotos auf, die den selbsternannten „Übergangspräsidenten“ Guaidó in gemeinsamen Posen mit kolumbianischen Paramilitärs zeigten. Guaidó behauptete, er hätte nicht gewusst mit wem er da zusammen fotografiert wurde.
Neueste Kommentare