Neue Broschüre: Schriften zum Klassenkampf VIII
Unsere neue Broschüre „Schriften zum Klassenkampf VIII“ (ca. 128 Seiten) von Soziale Befreiung ist da. Die Broschüre könnt Ihr hier für 5-€ (inkl. Porto) über Onlinemarktplatz für Bücher booklooker.de oder direkt bei uns auch als E-Book bestellen.
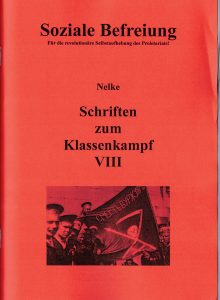
Inhalt
Einleitung
Die materialistische Dialektik als geistiger Ausdruck des Klassenkampfes
1. Die materialistisch-dialektische Denkmethode
2. Die idealistische Dialektik Hegels
3. Der naturwissenschaftliche Materialismus als technokratische Ideologie der Bourgeoise
4. Der Marxismus als kleinbürgerlich-radikale Ideologie
5. Der Marxismus-Leninismus als Ideologie bürgerlicher Partei- und Staatsapparate
6. Die materialistische Dialektik als geistige Waffe der sozialen Revolution
Zur Dialektik des Klassenkampfes
I. Das dialektische Dreiecksverhältnis Kapital – Lohnarbeit – Politik
1. Einheit und Kampf von Kapital und Lohnarbeit
2. Bürgerliche Politik als scheinneutraler Schiedsrichter der Konkurrenz- und Klassenkämpfe
3. Das Nationalkapital als Kooperation und Konkurrenz der Einzelkapitale
4. Einheit und Kampf von Staat und Lohnarbeit
II. Der Klassenkampf
1. Notwendigkeit und Zufall des Klassenkampfes
2. Der reproduktive Klassenkampf als Bewegungsform des dialektischen Widerspruches Kapital – Lohnarbeit
3. Sozialkonservative, modernisierende und revolutionäre Tendenzen des reproduktiven Klassenkampfes
4. Sein und Bewusstsein des Proletariats
III. Institutionalisierte ArbeiterInnenbewegung
1. Die institutionalisierte ArbeiterInnenbewegung als bürokratisch entfremdeter Ausdruck des reproduktiven Klassenkampfes
2. Die Dialektik aus Sozialreformismus und Konterrevolution/Reaktion
3. Die Dekadenz von Parteimarxismus und Anarchosyndikalismus als sozialrevolutionäre Theorien
4. Die revolutionäre Potenz der klassenkämpferischen Selbstorganisation des Proletariats
IV. Die mögliche revolutionäre Selbstaufhebung des Proletariats
1. Die objektiv-subjektive revolutionäre Situation
2. Der qualitative Umschlag von der proletarisch-klassenkämpferischen zur klassenlosen Selbstorganisation
3. Die revolutionäre Selbstaufhebung des Proletariats als mögliche Aufhebung des dialektischen Dreiecksverhältnisses
Warenproduktion – Politik – Lohnarbeit
Krisenhafte Kapitalvermehrung und Klassenkampf
I. Die Krisenmöglichkeiten der Kapitalvermehrungsspirale
1. Die Kapitalvermehrungsspirale
2. Rohstoffkrisen
3. Überausbeutung des Proletariats/Arbeitskräfteknappheit
4. Technologische Krisen
5. Profitproduktionskrisen
6. Profitrealisationskrisen
7. Finanzkrisen
II. Klassenkampf und Kapitalvermehrung
1. Der reproduktive Klassenkampf in der beschleunigten Vermehrung des Kapitals
2. Kapitalistische Krise und Klassenkampf
III. Das Proletariat als Objekt und Subjekt der kapitalistischen Krise
1. Das Proletariat als Objekt der Krise
2. Das Proletariat als Subjekt der Krise
Die revolutionäre Potenz der klassenkämpferischen Selbstorganisation des Proletariats
Der antipolitische und gewerkschaftsfeindliche Kommunismus orientiert konsequent auf die klassenkämpferische Selbstorganisation des Proletariats gegen Kapital, Staat sowie die bürgerlichen Partei- und Gewerkschaftsapparate der institutionalisierten ArbeiterInnenbewegung. Proletarische Selbstorganisation ist ein dialektischer Widerspruch. Er entfaltet sich aus der gegensätzlichen Einheit der beiden Pole „Proletariat“ und „Selbstorganisation“. Im Normalfall der kapitalistischen Ausbeutung, der politisch-staatlichen Verwaltung und der gewerkschaftlich gezähmten „Tarifauseinandersetzung“ ist das Proletariat das Objekt der bürgerlich-bürokratischen Fremdorganisation. Durch das demokratische Streikrecht entscheiden selbst über das wichtigste proletarische Kampfmittel, die Arbeitsniederlegung, die Gewerkschaftsapparate – deren hauptamtlichen Bonzen sozial selbst nicht zum Proletariat gehören (siehe Kapitel III.1 dieser Schrift).
Nur durch und im Klassenkampf kann sich das Proletariat kollektiv selbst für seine eigenen Interessen und Bedürfnisse organisieren. Gewerkschaften können und wollen nicht den konspirativ-illegalen Alltagsklassenkampf (siehe zu diesem Kapitel II.4 in diesem Text) organisieren. Dieser ist also selbstorganisiert. Deshalb entfaltet er seine ganze revolutionäre Potenz. ArbeiterInnen hören faktisch nicht auf ihre Bosse, machen Produktionsmittel – die nicht ihnen gehören, sondern kapitalistisches Eigentum darstellen – kaputt oder eignen sie sich – wo das möglich und sinnvoll ist – produktiv an. Auch kleinere Produktionsmittel und Produkte können innerhalb des Produktionsprozesses angeeignet werden, indem sie durch eine Ortsverlagerung in die Haushalte des Proletariats gelangen.
Doch die vorübergehenden Zerstörungen der kapitalistischen Produktionsmittel – dieser gewaltigen Zerstörungsmittel des Kapitals gegen Natur und Mensch – können die Produktionsweise nicht aufheben. Die Umverteilung kleinerer Produktionsmittel und Produkte können nicht verhindern, dass der Großteil des gesellschaftlichen Reichtums von der Bourgeoisie angeeignet wird. Das faktische Nichthören auf die Bosse ändert nicht viel an der Tatsache, dass sie offiziell das Sagen haben. Das Proletariat bleibt trotz des konspirativ-illegalen Alltagsklassenkampfes als Ausdruck dessen aktiver Selbstorganisation im Großen und Ganzen Objekt der kapitalistisch-staatlichen Fremdorganisation. Bleibt die Selbstorganisation proletarisch, kann sie die kapitalistische Fremdorganisation nicht zerstören. Die Selbstorganisation muss also ihren proletarischen Charakter verlieren, um die kapitalistische Fremdorganisation aufheben zu können. Das Proletariat kann die kapitalistische Fremdorganisation nur über sich aufheben, indem es sich selbst revolutionär aufhebt. Die klassenkämpferische Selbstorganisation des Proletariats ist eine gewaltige revolutionäre Tendenz. Das Proletariat lehnt sich gegen die kapitalistische Fremdorganisation auf, es zeigt, dass es viel mehr ist als menschliches produktives Kapital, dass den Mehrwert für die Bourgeoisie und ihr eigenes Elend produziert. Doch solange sich der proletarische Klassenkampf reproduktiv im Rahmen des Kapitalismus bewegt, kann die Selbstorganisation der Ausgebeuteten nicht ihr gesamtes revolutionäres Potenzial entfalten. Im reproduktiven Klassenkampf bewegt sich der dialektische Widerspruch zwischen den Polen „proletarisch“ und „Selbstorganisation“. Er kann nur progressiv durch die revolutionäre Selbstaufhebung des Proletariats gelöst werden – durch den qualitativen Umschlag von der proletarischen in die klassenlose Selbstorganisation (siehe Kapitel IV.2 dieser Schrift).
Die militante Form der klassenkämpferischen Selbstorganisation ist die Diktatur des Proletariats. Diese ist keine Staatsform, wie der Parteimarxismus behauptet, sondern der militante Kampf des Proletariats gegen Kapital und Staat. Sie ist Zwang und Gewalt des Proletariats, die dieses im Kampf mit dem kapitalistischen Management sowie den betrieblichen (Werkschutz) und staatlichen Repressionsorganen (Bullen, Armee, Geheimdienste) ausübt. Die proletarische Diktatur ist eine gewaltige Zuspitzung des dialektischen Widerspruches der klassenkämpferischen Selbstorganisation. Die Geschlagenen und Getretenen der kapitalistischen Produktionsweise schlagen und treten zurück! Proletarische Diktaturen entwickeln sich bereits ansatzweise im reproduktiven Klassenkampf und erreichen in der möglichen sozialen Revolution ihren Höhepunkt. Möglicherweise zerschlägt die revolutionäre Diktatur des Proletariats den Staat und geht prozesshaft in die klassen- und staatenlose Gesellschaft über.
Ansätze der proletarischen Selbstorganisation und Diktatur entwickeln sich schon in noch offiziell von den Gewerkschaften organisierten Klassenkämpfen. Besonders in länger andauernden Arbeitsniederlegungen entwickelt sich die Doppelherrschaft aus hauptamtlichen GewerkschaftsfunktionärInnen und dem selbstorganisierten Proletariat. Gewerkschaftliche Vertrauensmänner und -frauen, das sind ProletarierInnen in ehrenamtlichen Gewerkschaftsfunktionen, stehen zwischen den Gewerkschaftsapparaten und der klassenkämpferischen Selbstorganisation. Oft sind sie subjektiv ehrliche AktivistInnen, sie versuchen die Gewerkschaftsstrukturen für den kollektiven Kampf ihrer Klasse zu nutzen. Dabei entstehen bei ihnen selbst Illusionen in die Gewerkschaften, die sie auch ihren KollegInnen und Klassengeschwistern vermitteln. Auch werden sie von den hauptamtlichen GewerkschaftsfunktionärInnen ausgenutzt, um die Organisation im Betrieb zu verankern. Proletarische RevolutionärInnen dürfen auch keine ehrenamtlichen Funktionen in den Gewerkschaften übernehmen, damit ihre vollständige praktische und geistige Unabhängigkeit von diesen bürgerlich-reaktionären Organisationen gewahrt bleibt.
Oft streben die einfachen Gewerkschaftsmitglieder und ehrenamtlichen FunktionärInnen im Klassenkampf nach radikaleren Aktionen als die hauptamtliche Bonzokratie. Wir wollen die Doppelherrschaft aus proletarischer Selbstorganisation und Gewerkschaftsbürokratie an Hand des sechsmonatigen Streiks bei Gate Gourmet Düsseldorf vom 7. Oktober 2005 bis 7. April 2006 erläutern. Die Arbeitsniederlegung wurde offiziell von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) organisiert. Doch vor dem Streik hatten klassenkämpferische KollegInnen bei Gate Gourmet bereits eine konspirative Untergrundorganisation, das U-Boot, gegründet. Dieses U-Boot kämpfte gegen die Ansätze der NGG-FunktionärInnen, den Ausstand zu beenden. Auch traten die AktivistInnen des U-Bootes dafür ein, den legalistischen Rahmen der Gewerkschaft im Kampf gegen die StreikbrecherInnen zu verlassen: „Es gab unter den Streikenden durchaus Überlegungen, wie sie ihren Streik effektiv machen könnten. Eine Zeit lang wurde über die Besetzung des Betriebes nachgedacht: Wäre es möglich, mit einer größeren Gruppe reinzugehen, die Arbeitsplätze zu besetzen und die Streikbrecher am Arbeiten zu hindern? Auch Sabotage und direkte Aktionen gegen Streikbrecher waren im Gespräch.
XXX: ,Ich hatte ein bisschen härtere Ideen, die Streikbrecher draußen ein bisschen aufzuhalten, richtig Druck zu machen, ihnen Prügel anzudrohen, so dass sie wirklich Angst bekommen. Ihnen zu sagen: ,Ich weiß, in welchem Hotel du bist, wir werden dich kriegen.‘ Und so weiter. Ich wollte niemand verletzen, nur ein bisschen Druck machen, ein bisschen Angst machen. Aber das ging nicht wegen der Gesetze in Deutschland. Wir leben nicht in der Dritten Welt. In meinem Land würden die sich mit der Pistole in der Hand oder mit dem Messer da hinstellen, so dass die Leute wirklich Angst bekommen und sofort abhauen. Ich hab ein paar Mal mit Leuten darüber diskutiert, aber viele von denen haben gar kein Interesse daran gehabt.‘
XXX: ,Die erste Blockade, die wir gemacht haben, damals als wir nach Hannover gefahren sind (18.11.05), da war ich dabei, da wär ich fast ausgeflippt. Später hab‘ ich gedacht: Wär ich doch auf den LKW gesprungen, durch das kleine Tor auf die Ladefläche, Klappe auf, und alles auf den Boden schmeißen. Aber an so etwas denkt man erst später.‘
XXX: ,Von dem Gewerkschaftssekretär hab ich immer die Sprüche zu hören gekriegt: ,Nicht mit Gewalt, wir lösen das irgendwie anders…‘. Ohne Gewalt kannst du so was nicht lösen. Da muss Gewalt drin sein. Ich hab‘ in der Türkei auch Streiks gesehen, nicht als Arbeiter mitgemacht, aber als Linker. Die haben uns immer gerufen, wo Streik war. Wir haben da viele Leute verkloppt. Wenn die reingehen an den Arbeitsplatz, während die draußen streiken, dann haben die uns Bescheid gesagt, und wir waren alle da. Da haben wir Streikbrecher verprügelt, ohne Gnade, also nicht so sehr… aber die konnten sechs Wochen nicht laufen. Die Kollegen haben da viel rausgeholt, das waren Bergleute…
Aber hier… jedes Mal, wenn wir gesagt haben ,Wir machen morgen was‘, dann hieß es von der Gewerkschaft: ,Nee, um Gottes Willen, das dürft ihr nicht!‘ Wir wollten nachts reingehen mit paar Kollegen, an die LKWs. Die Security hätte uns gar nicht gesehen. So was haben wir geplant. Aber es hieß: ,Nein, so was gibt‘s nicht.‘ Ich habe vorgeschlagen, das wir das unter uns machen, und dass nicht der Gewerkschaft sagen. Dass wir das ganz geheim machen. Aber dann hieß es: ,Wenn die uns sehen, dann kriegt die Gewerkschaft eins drüber, und dann kriegen wir kein Geld mehr.‘ Davor hatten wir ja auch Schiss.“ (Flying Pickets, …auf den Geschmack gekommen. Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet, Assoziation A, Berlin – Hamburg 2007, S. 153/154.)
Wir sehen hier deutlich, dass Deutschland ein Entwicklungsland des militanten Klassenkampfes ist. Es ist eine revolutionäre Tendenz im reproduktiven Klassenkampf, wenn ArbeiterInnen praktisch das staatliche Gewaltmonopol in Frage stellen. Doch die Gewerkschaften sind in die kapitalistische Warenproduktion und in die durch staatliche Gesetze regulierte Wirtschaftsdemokratie eingebunden. Besonders die deutschen Gewerkschaften erkennen sklavisch das staatliche Gewaltmonopol an, selbst wenn sie von diesen eingeschränkt oder sogar zerschlagen werden, wie im Mai 1933. Das staatliche Gewaltmonopol in Frage zu stellen, heißt das Streikmonopol der Gewerkschaften in Frage zu stellen.
Wir sehen hier deutlich, welch disziplinarischen Charakter das gewerkschaftliche Streikgeld hat. Wir haben oben geschrieben, dass dieses Geld auch für sozialrevolutionäre ArbeiterInnen ein Grund sein könnte, diesen Streikbrecherorganen des Kapitals beizutreten, aber auch geschrieben, dass dies nicht die Aktivitäten einschränken darf. Doch die Angst vor dem Nichtauszahlen des Streikgeldes hat bei Gate Gourmet die Aktivität gelähmt. Hier hätte mensch auch auf die finanzielle Solidarität des Proletariats setzen sollen, auf die organisierte Sammlung von Solidaritätsgeldern, falls die Gewerkschaft bei militanten Aktionen kein Streikgeld mehr gezahlt hätte. Auch kann die Forderung nach Bezahlung der Streiktage durch das bestreikte Unternehmen zum Teil des Klassenkampfes gemacht werden. Doch leider kam es bei Gate Gourmet noch zu keiner solchen Radikalisierung des Kampfes.
Das Monopol der Gewerkschaft NGG konnte nicht gebrochen werden, die proletarische Untergrundorganisation konnte sich nicht in einer sichtbaren proletarischen Selbstorganisation, welche die kollektive Meinung der Mehrheit der ArbeiterInnen zum Ausdruck brachte, auflösen, der Kampf blieb größtenteils isoliert… Und doch gab es die Ansätze der proletarischen Selbstorganisation, welche zwar die Gewerkschaft noch nicht ersetzen konnte, aber doch teilweise vor sich hertreiben konnte und zum Beispiel den Abbruch des Vollstreiks im Januar 2006 verhindern konnte.
Das „U-Boot“ konnte also nicht in einer breiteren Form der proletarischen Selbstorganisation aufgehen. Ein Kollege des U-Bootes wurde zum Pressesprecher der Streikenden und übte so Druck auf die Gewerkschaftsbürokratie aus: „Ohne die eigenständige Aktivität einzelner KollegInnen wäre der Streik sicher nicht so lange durchgehalten worden. Das ,U-Boot‘ agierte als informelle Streikleitung. Nicht als geschlossene Gruppe, sondern als Netzwerk von KollegInnen, die sich aktiv selbst um ihren Streik kümmerten. Sie hielten sich stundenlang am Streikzelt auf, um immer wieder den Zusammenhalt herzustellen und mit den KollegInnen zu diskutieren – ,Was ich da für Volksreden gehalten habe, damit die immer in die richtige Richtung marschieren!‘ Und sie nahmen der NGG manche Aufgaben, wie die Pressearbeit aus der Hand.
XXX: ,Die Aktivisten, das waren höchstens mal sieben Leute, die den Streik äußerst aktiv gesteuert haben. Wir haben uns aufgeteilt, das war noch nicht mal geplant, wer welchen Bereich übernimmt. Das ist chaotisch gelaufen, aber ich bin stolz, so einen Kollegen wie X. kennengelernt zu haben. Vorher kannte ich den auch, aber als Arbeitskollegen. Und dann kam diese perfekte Zusammenarbeit. Wir brauchten nie irgendwas abmachen. Wir hatten keine Extra-Treffen, überhaupt nichts. Jeder kannte seine Schwächen und seine Stärken, und hat automatisch das gemacht, was richtig ist. Wenn wir hinterher was absprechen wollten, ist das meistens in die Hose gegangen. Das war das Interessante! Aber was wir vorher schon gemacht haben, wenn wir nachher darüber gesprochen haben, dann passte das zusammen.
X. war Frühaufsteher. Ich gehe nachts hinein, bis zum Morgengrauen, aber dann brauche ich ein bisschen Zeit, bis ich anlaufe. Deswegen hat er die Stimmung vom Morgen aufgefangen. Der hat die Stimmung von den Leuten an mich weitergegeben. X. und ich haben die Hauptrolle gespielt, aber doch nicht die Hauptrolle, weil wir das hinten rum gemacht haben. Was die Gewerkschaft gemacht hat, das war trotz der ihrer fehlenden Erfahrung super. Aber die sind an Grenzen gestoßen. Als wir das festgestellt haben, haben wir gedacht, wir müssen das ändern. Wir haben das immer wieder geändert. Wir mussten die Stimmung immer unheimlich schnell auffangen, um die Manipulationsgefahr, die aus manchen Ecken kam, vermeiden zu können. Wir haben die Schichten eingeteilt, und wir haben an den entsprechenden Zeitpunkten entsprechende Leute eingesetzt. Damit das nicht schiefläuft. Wenn ein Virus einmal anfängt, wissen wir, was passiert, das kannst du so schnell nicht wieder retten. Gerade wo wir nicht gesund sind.‘
Der ,neoliberale Virus‘ hatte sich vor dem Streik im Betrieb verbreitet: KollegInnen haben sich negativ verändert, sind zu KonkurrentInnen geworden, waren neidisch auf andere und nur auf den eigenen Vorteil bedacht. In der Streikroutine, in der Streiken fast zur lästigen Arbeit wurde, kamen solche Haltungen wieder durch.
XXX: ,Nach 150 Streiktagen gibt es jetzt schon wieder so kleine Reibereien: ,Der macht nur Frühschicht, wieso macht der keine Spätschicht, wieso arbeitet der nicht am Wochenende?‘ Diese Mentalität rutscht langsam wieder rein. Aber dann kommen der X. und ich natürlich mit der Spritze und machen den wieder weg den Virus.
Das war der schwierigste Job überhaupt, dass du dir die einzelnen Leute, die Unruhe gestiftet haben, geschnappt hast und denen gleich den Nährstoff entzogen hast. Da musstest Du immer sehen, dass Du die Belegschaft auf einem bestimmten Level hältst, immer schön in eine bestimmte Richtung pushst. Die Gewerkschaft hat das richtig geärgert, dass wir die Belegschaft so im Griff gehabt haben. Die haben ja auch versucht, die Belegschaft zu beeinflussen.‘
Die NGG gab während des Streiks eine Streikzeitung heraus, die am Streikzelt verteilt wurde und im Internet zu lesen war. In den ersten zweieinhalb Monaten erschien sie täglich, danach zwei bis dreimal pro Woche. Sie war schön gemacht: Auf der Vorderseite gab es die neuesten Informationen, und auf der Rückseite wurde unter der Überschrift ,Menschen, die dahinter stehen‘ jeweils eine oder einer der Streikenden mit Foto vorgestellt. An der Zeitung waren streikende Kollegen maßgeblich beteiligt. Sie gaben ihre Beiträge und Fotos einer Hauptamtlichen. Aber nicht alles, was die Streikenden einreichten und gerne in der Zeitung gesehen hätten, fanden sie nachher dort wieder. Sie sprachen von ,Zensur‘. Die NGG nutzte die Streikzeitung, um ihre Linie zu propagieren und Kritik an den Streikenden zu äußern. Im November warnte sie vor ,Aktionismus‘ und am 14. März ermahnte sie zu mehr ,Streikdisziplin‘. Diese Rüge sehen Kollegen als Retourkutsche auf die Streikversammlung am Vortag, bei der die Gewerkschaft von den Streikenden massiv kritisiert wurde. Die Tarifkommission forderte danach, ,dass die Streikzeitung bei uns durch die Zensur geht‘. Außerdem war aufgefallen, dass die Pressearbeit der Gewerkschaft mit der Zeit schwächer wurde. Da sie den Streik lieber beendet hätte, hatte sie kein Interesse mehr an großer Öffentlichkeit. Kollegen übernahmen diese Aufgabe und nutzten ihre Kontakte zur Presse, um die Gewerkschaft zur Fortsetzung des Streiks zu drängen.
XXX: ,T. G. (Hauptamtlicher der Bezirksleitung) hat gedroht: ,Dann brech ich eben den Streik ab.‘ Satzungsgemäß geht das. Dann hab‘ ich immer gesagt: ,Thomas, tu das. Ich kümmer‘ mich dann um den Rest. Ich hab‘ jetzt mittlerweile so viele Pressekontakte, gerade jetzt in der Streikwelle, wenn Du den Streik abbrechen willst… das ist natürlich ne gute Werbung für die NGG, wenn da stehen würde: Erste Gewerkschaft bricht Streik ab.‘ Da hat er nachher die Hände von gelassen. Irgendwann, so etwa drei Verhandlungen vor Schluss, hat der auch begriffen, dass nichts zu machen ist, ohne uns dabei zu haben. Das hat der begriffen.
Jedes Mal, wenn der anfing mit Streikabbruch, Streiktaktik ändern, hab‘ ich mein Büchelchen aufgeschlagen mit den ganzen Visitenkarten von der Presse. Da hat der die Krise gekriegt, da ist der wahnsinnig geworden. Dann hat das Telefon geklingelt – das war auch in einer kritischen Phase gewesen – da war jemand vom Express dran: ,Hach‘, hab ich gesagt, ,ich weiß da jetzt auch nicht so, ich geb‘ mal die Hauptamtliche.‘ Da war die in Not. Der hat ihr dann auch die Frage gestellt: ,Wann brecht ihr den Streik ab?‘ Und die waren nachher gar nicht mehr in der Lage gewesen, zu sagen, wir brechen ab, wir ziehen das in Erwägung. Die mussten einfach Position beziehen und mussten sagen: ,Wir machen den Streik so lange, wie er geht.‘“ (Ebenda, S. 156-158.)
Wir sehen deutlich die Doppelherrschaft bei der Führung des Streiks zwischen Gewerkschaftsbürokratie und U-Boot. Die soziale Schwäche der Streikenden (fehlende Ausdehnung des Kampfes auf andere Gate-Gourmet-Standorte und darüber hinaus, mangelnder Grad der Radikalisierung) machte es unmöglich, der Gewerkschaft offensichtlich die Führung des Streiks abzunehmen. Auch die U-Boot-Mitglieder waren in der Gewerkschaftsfrage nicht frei von Inkonsequenzen und Illusionen. Leider ist bei ihnen auch Spuren einer für militante/revolutionäre ArbeiterInnen gefährlichen Eigenschaft zu spüren: Avantgarde-Hochmut. Der kommt besonders in folgender Aussage zum Ausdruck: „Die Gewerkschaft hat das richtig geärgert, dass wir die Belegschaft so im Griff gehabt haben. Die haben ja auch versucht, die Belegschaft zu beeinflussen.“ Militante/revolutionäre ArbeiterInnen haben aber nicht mit den Gewerkschaftsbonzen um die Führung der KollegInnen zu konkurrieren, sondern sie müssen für die kollektive Selbstorganisation der Belegschaft eintreten. Nicht die Belegschaft im Griff zu haben ist ein Gradmesser für militante/revolutionäre Betriebsaktivität, sondern wie weit es gelingt mit dazu beizutragen, dass sich die Belegschaft selbst im Griff hat. Diese grundsätzliche Orientierung auf die kollektive Selbstorganisation schließt Repression gegen einzelne reaktionäre KollegInnen nicht aus, wenn diese zum Beispiel durch rassistisches und sexistisches Verhalten den Klassenkampf behindern.
Das U-Boot war eine konspirative Organisation klassenkämpferischer KollegInnen, aber keine bewusst gewerkschaftsfeindliche sozialrevolutionäre Betriebsgruppe. So waren die KollegInnen auch Teil der Tarifkommission. Damit übernahmen sie Funktionen innerhalb der Verwaltung der Lohnarbeit. Dies dürfen bewusste SozialrevolutionärInnen auf keinem Fall tun. Das U-Boot ist aber in ihrer konspirativen Organisation ein Vorbild für sozialrevolutionäre Betriebsgruppen. Für sozialrevolutionäre Gruppen, deren organisatorische Grundlage nicht der Betrieb ist, empfiehlt sich eine halblegal-halbkonspirative Organisationsform. Sozialrevolutionäre Gruppen – besonders die Betriebsgruppen – sind der bewusste geistig-praktische Ausdruck der klassenkämpferischen Selbstorganisation des Proletariats. Sie verkörpern die Selbstorganisation der proletarischen und intellektuellen RevolutionärInnen. Sozialrevolutionäre Gruppen dürfen weder wie Parteien noch wie Gewerkschaften organisiert sein. In ihnen darf es keine hauptamtlichen Funktionen geben. Sie müssen die größtmögliche individuelle und kollektive Eigenaktivität aller Mitglieder anstreben.
Sozialrevolutionäre Gruppen treten bereits im reproduktiven Klassenkampf dafür ein, dass das Streikmonopol der zentralen Gewerkschaftsapparate gebrochen wird. Höchster Ausdruck der proletarischen Selbstorganisation im reproduktiven Klassenkampf ist der wilde Streik, die Arbeitsniederlegung ohne und gegen den Willen der zentralen Gewerkschaftsbonzen. Höhepunkte des selbstorganisierten Klassenkampfes in der BRD waren die wilden Streikwellen im September 1969 und im Jahre 1973, das proletarische 1968 in diesem Land. Bedeutend war auch der sechstägige selbstorganisierte Ausstand bei Opel Bochum im Oktober 2004. In kleineren und auf einzelne Betriebe beschränkte wilde Ausstände kommt die klassenkämpferische Selbstorganisation der Streikenden oft informell zum Ausdruck. Dauern die Arbeitsniederlegungen jedoch länger an und/oder muss der selbstorganisierte Klassenkampf mehrerer Betriebe koordiniert werden, dann ist die Bildung eines gewerkschaftsunabhängigen Streikkomitees notwendig. In letzteren ist auch keimhaft eine organisatorische Alternative zu den Gewerkschaften verkörpert. Allerdings nur für die Dauer eines Ausstandes. Ein unabhängiges Streikkomitee ohne Streik ist wie ein Fisch auf dem Trockenem.
Neueste Kommentare