Neue Broschürenreihe: Schriften zum Klassenkampf
Schriften zum Klassenkampf ist eine unregelmäßig erscheinende Serie der Sozialen Befreiung und Gruppe Sozialer Widerstand mit Texten über die globalen Auseinandersetzungen des Proletariats mit Kapital, Staat und Patriarchat im 20. und 21. Jahrhundert. Die Broschüre „Schriften zum Klassenkampf I“ (ca. 104 Seiten) könnt Ihr für 5-€ (inkl. Porto) hier über Onlinemarktplatz für Bücher booklooker.de oder direkt bei uns auch als E-Book bestellen.
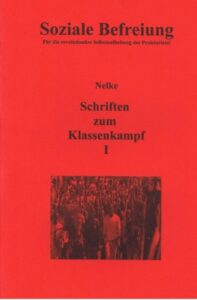
Inhalt
Einleitung
Proletarische Selbstorganisation als dialektischer Widerspruch
1. Das Proletariat
2. Die revolutionäre Selbstaufhebung des Proletariats
3. Proletarische Selbstorganisation als dialektischer Widerspruch
4. Die spontane Besetzung des Betriebes bei Bike Systems.
5. Die „selbst verwaltete“ kleinbürgerlich-kollektive Produktion des Strike Bike
6. Proletarische Selbstorganisation im Ausbeutungsprozess
7. Vorbild Argentinien
8. Die punktuelle Aufhebung der Ware-Geld-Beziehung im Klassenkampf
9. Die Diktatur des Proletariats
10. Von der proletarischen zur klassenlosen Selbstorganisation!
Hungerrevolten (Food Riots) und die revolutionäre Aufhebung der
Warenproduktion
1. Die strukturelle Nahrungsmittelkrise für das Proletariat
2. Die weltweiten Hungerrevolten
3. Die strukturelle Lebensmittelkrise bleibt bestehen
4. Die strukturelle Lebensmittelkrise in den Zentren des Kapitalismus
5. Die tendenzielle Aufhebung des Warencharakters von Lebensmitteln durch
Klassenkampf
Klassenkämpfe gegen Betriebsschließungen.
1. Der widersprüchliche Charakter des Kampfes um Arbeitsplätze
2. Rheinhausen
3. AEG in Nürnberg
4. BSH Berlin
Gelungene Demokratisierung in Südafrika – Das ANC-Regime gegen das Proletariat
1. Von der Apartheid zum ANC-Regime
2. Die institutionalisierte ArbeiterInnenbewegung und das Proletariat in Südafrika.
3. Demagogie und Terror des ANC-Regimes.
4. Revolutionärer Kampf gegen das ANC-Regim
Proletarische Selbstorganisation als dialektischer Widerspruch Erläutert an Beispielen des Klassenkampfes (Bike Systems in Nordhausen (2007) und Betriebsbesetzungen und U-Bahn-Streik in Argentinien)
1. Das Proletariat
Zum modernen Proletariat, den Besitzlosen im Kapitalismus, gehören alle die Menschen, die nicht zu den kleinen (KleinbürgerInnen) oder großen ProduktionsmittelbesitzerInnen (KapitalistInnen) bzw. FreiberuflerInnen gehören, privilegierte VerwalterInnen des kapitalistischen Produktionsprozesses (ManagerInnen, hohe Verwaltungsangestellte und Chefs in der materiellen Produktion), über Geld- (Banken, Versicherungen) und Handelskapital verfügen und nicht die Gesellschaft politisch verwalten (PolitikerInnen, BeamtInnen, privilegierte Staatsangestellte und jene, die vorwiegend Repressionsfunktionen ausüben). Außerdem ist das Proletariat auch vom lohnabhängigen KleinbürgerInnentum (StaatsbeamtInnen, Lohnabhängige von privaten SöldnerInnenfirmen, privilegierte Berufe wie ÄrztInnen, IngenieurInnen und ZeitungsredakteurInnen) zu unterscheiden, wobei natürlich zu beachten ist, dass die Grenzen fließend sind und es gerade in den letzten Jahren einen enormen Proletarisierungsschub bei einigen lohnabhängigen KleinbürgerInnen gab.
Dieses moderne Proletariat bestand und besteht im Wesentlichen aus doppelt freien LohnarbeiterInnen, nichtfreien ArbeiterInnen (u. a. in faschistischen KZs, im sowjetischen Gulag aber auch in demokratischen Gefängnissen), vorwiegend weiblichen innerfamiliären HausarbeiterInnen und aus nicht lohnarbeitenden Unterschichten (Erwerbslose und Obdachlose). Diese nicht lohnarbeitenden Schichten gehören nicht zur ArbeiterInnenklasse, aber zum Proletariat. Das Proletariat ist ein soziales Feld, was sich im Kern zur Klasse, zur ArbeiterInnenklasse, verdichtet und an der Peripherie zu nicht lohnarbeitenden Schichten ausläuft. Das Weltproletariat ist somit zahlenmäßig größer als die die globale ArbeiterInnenklasse.
Die doppelt freien LohnarbeiterInnen sind negativ frei von Produktionsmitteln, welche kleinbürgerliches, privatkapitalistisches und staatskapitalistisches Eigentum bilden, verfügen allerdings auch über die positive Freiheit über ihren eigenen Körper. Diese doppelte Freiheit ist also der ökonomische Zwang der proletarisierten Menschen, ihre eigene Arbeitskraft an das KleinbürgerInnentum, das Kapital oder den Staat – eben an die BesitzerInnen der Produktionsmittel – zu vermieten.
Die eigene Arbeitskraft vermieten zu müssen – dass ist das Elend der proletarischen Existenz und gleichzeitig die Quelle des kapitalistischen Reichtums. Erst wo die Arbeitskraft massenhaft eine Ware von doppelt freien LohnarbeiterInnen ist, und nicht mehr überwiegend individuell auf eigene Rechnung von kleinen WarenproduzentInnen (HandwerkerInnen, kleine freie BäuerInnen) und/oder von unfreien ArbeiterInnen (Leibeigene, SklavInnen) verrichtet wird, ist die vorherige kleinbürgerliche Warenproduktion kapitalistisch geworden. Die Arbeitskraft als Ware der ArbeitskraftbesitzerInnen bedeutet, dass fast alles zur Ware geworden ist.
Die ProletarierInnen, die auf dem Arbeitsmarkt ihre Arbeitskraft vermieten müssen, um sich auf dem Konsumgütermarkt, die Dinge zu kaufen, die sie zum Leben brauchen, sind kleinbürgerliche Marktsubjekte. Nicht in der engen Klassendefinition von kleinbürgerlich, also nicht im Sinne von kleinen ProduktionsmittelbesitzerInnen, sondern im Sinne von kleinen BürgerInnen der bürgerlichen Gesellschaft. Der/die Proletarier/in vermietet seine/ihre Arbeitskraft und kauft Konsumgüter – ganz gewohnheitsmäßig, die Ware-Geld-Beziehung ist ihm/ihr nichts Äußerliches. Die meisten ProletarierInnen halten die asoziale Ware-Geld-Beziehung für etwas ganz normales. Das Proletariat führt seinen reproduktiven Klassenkampf für mehr Geld, erst das revolutionär gewordene Proletariat wird möglicherweise die kapitalistische Warenproduktion von innen heraus sprengen.
Die ProletarierInnen als kleinbürgerliche Marktsubjekte sind nicht zu idealisieren, so wenig wie KleinbürgerInnen überhaupt zu idealisieren sind. Sie sind zuweilen ekelhafte Konkurrenzindividuen, die auf dem Arbeitsmarkt gegen andere Individuen ihrer Klasse konkurrieren. Auf dem Arbeitsmarkt sind die ProletarierInnen gar keine kollektiv handelnde Klasse, sondern eben nur Marktindividuen. Der kleinbürgerliche Individualismus lebt sich im Marktsubjektivismus der ProletarierInnen genau so aus wie im Rassismus und Sexismus als Ideologien des Verdrängungskonkurrenzkampfes um Jobs. AusländerInnen raus und Frauen an den Herd, es lebe die ordentliche nationale und männliche Arbeit! Dieser Schlachtruf des proletarischen Chauvinismus ist nicht nur Folge von Beeinflussung durch bürgerlich-reaktionäre Ideologie, sondern findet in der Marktsubjektivität des Proletariats seine Wurzel.
Auch die sozialdarwinistische Hetzte gegen jene proletarischen Unterschichten, welche ihre Arbeitskraft nicht (mehr) vermieten können oder wollen, und nur Dank staatlicher Almosen überleben, findet leider bei nicht wenigen lohnarbeitenden ProletarierInnen aus dem selben Grunde Zustimmung. Hier wird den „Asozialen“ von Seiten lohnabhängiger SpießerInnen nicht die geringe Marktsubjektivität auf den Konsumgütermärkten gegönnt. Gegenseitiger Neid und Missgunst unter dem Mantel bürgerlicher Moral verborgen, dass ist das typische Verhalten von bürgerlichen Konkurrenzindividuen.
Auch die eigene Unterwerfung auf dem Arbeitsmarkt, wo sich der/die moderne Proletarier/in seine/ihre eigene Arbeitskraft, also sich selbst, an das KleinbürgerInnentum, an das Kapital und den Staat vermieten muss, praktisch als sein/ihre eigene/r Sklavenhändler/in auftritt, werden durch Rassismus, Sexismus und Sozialdawinismus kompensiert. Eine andere Form der Kompensation der Unterwürfigkeit auf dem Arbeitsmarkt ist das rauschhafte Austoben auf den verschiedenen Konsumgütermärkten, auf denen nicht selten der Preis der vermieteten Arbeitskraft entweder für unnütze und/oder sogar schädliche Produkte ausgegeben wird. Die Unterwerfung unter die Zumutungen des Arbeitsmarktes, um sich das neuste Handy leisten zu können, dass zwei Funktionen mehr hat als das alte. Die moderne Konsumgüterproduktion als Glasperlen für das Proletariat, damit dieses weiterhin ihre Arbeitskraft vermietet.
Die kleinbürgerliche Jagt nach Glasperlen, an der auch nicht wenige ProletatrierInnen mit etwas mehr Geld teilnehmen, als Kompensation für Dinge, die mensch nicht kaufen kann, aber durch die Ware-Geld-Beziehung permanent zersetzt werden: Freundschaft, Liebe, gegenseitigen Respekt und Solidarität.
In der Kaufsucht, einer medizinisch anerkannten Krankheit, wie sie nur in einer kapitalistischen Warenproduktion auftreten kann, und an der auch besser verdienende ProletarierInnen erkranken können, erreicht die Herrschaft der Ware-Geld-Beziehung über das Verhalten, Denken und Fühlen der Menschen ihren traurigen Höhepunkt: Nur das Besitzen von Geld und Dingen, die mensch dafür kaufen kann, ist wahres Sein! Die Dinge – Geld und Waren – welche ursprünglich die Produkte menschlichen Verhaltens sind, beherrschen nun die Menschen, bis zur Kaufsucht als krankhafter Übertreibung der kleinbürgerlichen Marktsubjektivität. Nicht die Menschen beherrschen die Dinge (Waren und Geld), sondern die Dinge beherrschen die Menschen. Dieser Verdinglichung sind alle bürgerlichen Marktsubjekte, also auch die ProletarierInnen, ausgesetzt.
Allerdings ist das Proletariat ein unterprivilegiertes Marktsubjekt. Unterkonsum an den wichtigsten Dingen des Überlebens ist auch in den Metropolen des Kapitalismus eine Massenerscheinung. Dieser Unterkonsum von großen Teilen des Weltproletariats hat etwas damit zu tun, das das Proletariat in seiner Funktion für die Kapitalvermehrung nicht in erster Linie Marktsubjekt, sondern Ausbeutungsobjekt ist. Die Arbeitskraft der doppelt freien LohnarbeiterInnen besitzt für ihre MieterInnen den Gebrauchswert, dass sie für diese andere Waren produzieren, welche mit Profit auf dem Markt verkauft werden können. Wer Produktionsmittel besitzt und die Arbeitskraft des Proletariats zur Warenproduktion mietet, ist ein privilegiertes Marktsubjekt, dass teilweise (KleinbürgerInnen, die auch noch selbst arbeiten müssen) oder ganz (KapitalistInnen) von der Ausbeutung des Proletariats lebt.
Die kleinbürgerlichen/kapitalistischen MieterInnen der Ware Arbeitskraft verkaufen die von der Arbeitskraft produzierten Waren auf den Markt. Das Proletariat produziert Waren für die MieterInnen seiner Arbeitskraft, nicht für sich selbst. Die kleinbürgerlichen/kapitalistischen MieterInnen der Ware Arbeitskraft bezahlen aus dem Erlös der vom Proletariat produzierten Waren auch den Lohn für das Proletariat, was sich dann von diesem die Konsumgüter kauft, die es zur seiner eigenen Reproduktion braucht.
Durch die massenhafte Ausbeutung der Ware Arbeitskraft wird die kleinbürgerliche Warenproduktion zur kapitalistischen. Fast alles wird zur Ware. Die Arbeitskraft besitzt wie jede andere Ware einen Gebrauchswert und einen Tauschwert. Der Gebrauchswert besteht aus deren nützlichen Eigenschaften, welche von den KäuferInnen der Waren genutzt wird, während der Tauschwert einer Ware in Form von Geld von den VerkäuferInnen einer Ware realisiert wird. Der Tauschwert ist nichts anderes als die durchschnittliche gesellschaftlich notwendige Herstellungszeit einer Ware. Der Preis ist der verselbständigte Geldausdruck des Tauschwertes einer Ware. Preise werden in letzter Instanz von ihrem Wert bestimmt, sind aber nicht mit diesem identisch, weil die Warenpreise auch durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt bestimmt werden.
Die Werttheorie ist für proletarische RevolutionärInnen alles andere als wertloser Müll aus der Geschichte der Wirtschaftstheorie. Nur die Werttheorie ist in der Lage, den Charakter des Geldes zu erklären. Denn was kostet ein bestimmtes Produkt menschlicher Tätigkeit in allen gesellschaftlichen Verhältnissen, also auch in solchen, wo es keine Waren und kein Geld gibt? Kraft und Zeit! Auch in der kapitalistischen Warenproduktion ist das so. Im Geld als verselbständigten Tauschwertes einer Ware verkörpert sich die Verausgabung menschlicher Tätigkeit. Geld stinkt nicht, sonst würde es vor allem nach proletarischem Schweiß riechen! In der Regel gilt: Produkte, die mehr Kraft und Zeit kosten, sind teurer als solche, in der weniger Arbeit vergegenständlicht ist. Die menschliche Arbeit des Proletariats bestimmt im Wesentlichen den Preis einer Ware und nicht die anonymen „Gesetze des Marktes“!
Die Verselbständigung des Geldes als Ausdruck des Warenwertes vollzog sich lange vor der Herausbildung des modernen Proletariats, schon in der kleinbürgerlichen Warenproduktion. Die Einseitigkeit der produktiven Tätigkeiten der kleinbürgerlichen WarenproduzentInnen und die Vielseitigkeit der menschlichen Bedürfnisse dieser KleinbürgerInnen machte das Geld erforderlich. Ein Bäcker hätte sonst alle Produkte seiner Bedürfnisse gegen Brot, Brötchen und Kuchen eintauschen müssen. Der Fleischer hätte so irgendwann mit großer Sicherheit gesagt: „Für dein Brot bekommst du von mir kein Fleisch. Hättest du Bier gehabt, hätte ich dir mein Fleisch gegeben.“ So tauscht der Bäcker seine Brote gegen Geld bei den Leuten, die Bedürfnisse danach verspüren und mit dem Geld, welches der verselbständigte Ausdruck des Tauschwertes des Brotes ist, kann er sich jederzeit Fleisch kaufen, da der Fleischer mit dem Geld alle Produkte seiner Bedürfnisse eintauschen kann.
Doch kommen wir zurück zur kapitalistischen Warenproduktion und den Gebrauchswert und den Tauschwert der Ware Arbeitskraft, welche das Proletariat an das KleinbürgerInnentum, KapitalistInnen und an den Staat vermietet. Der Gebrauchswert der Arbeitskraft besteht für deren kapitalistischen AusbeuterInnen darin, dass sie mehr Wert produziert als ihr eigener Tauschwert/ihr Lohn beträgt.
Wodurch wird nun der Tauschwert/der Preis/der Lohn für die Ware Arbeitskraft bestimmt? Der Lohn kann aus kapitalistischer Sicht nicht niedrig genug sein, während er aus proletarischer Sicht nicht hoch genug sein kann. Aus kapitalistischer Sicht muss er wenigstens so niedrig sein, dass die ArbeiterInnen profitabel arbeiten, für den Arbeiter/die Arbeiterin muss der Lohn wenigstens so hoch sein, dass er/sie von ihm leben kann und dass neue ArbeiterInnen durch Fortpflanzung erzeugt werden können. Wie hoch der Lohn tatsächlich ist, entscheidet also im nicht geringen Maße der reale Klassenkampf. Wir sehen also, dass mit der kleinbürgerlichen Marktsubjektivität die proletarische Klassenkampfsubjektivität bei den LohnarbeiterInnen auf das Engste miteinander verbunden ist.
…..
Innerhalb des Produktionsprozesses ist das Proletariat selbst menschliches produktives Kapital, welches für die MieterInnen ihrer Arbeitskraft den Profit produziert. Durch die Mietung der Ware Arbeitskraft wird von Seiten des Kapitals Geldkapital in menschliches produktives Kapital umgewandelt. Für das Kapital sind die Lohngelder für das Proletariat die Geldform des menschlichen produktiven Kapitals, für das Proletariat selbst ist es die Geldform seines Konsumtionsfonds.
Im Produktionsprozess ist das Proletariat ein Ausbeutungsobjekt. Der Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft, mehr Tauschwert zu produzieren, als es selbst besitzt, wird vom Kapital ausgebeutet.
Die Produktionsmittel, welches kapitalistisches Privat- oder Staateigentum bilden, sind die Waffen des Kapitals, mit deren Hilfe der Mehrwert aus dem Proletariat herausgepresst wird. Die Produktionsmittel bilden das sachliche produktive Kapital. Die fungierende Arbeitskraft bearbeitet einen Arbeitsgegenstand (Rohstoff, Halbfabrikat) mit Hilfe von Arbeitsmitteln (Werkzeuge, Maschinen) weiter zum fertigen Produkt, welches als Ware auf den verschiedenen Märkten verkauft werden kann. Sie überträgt den Wert der Produktionsmittel auf das Produkt. Der Wert des Arbeitsgegenstandes geht voll in den Wert des Produktes auf, während der Wert der Arbeitsmittel stückweise auf den Wert der mit ihrer Hilfe während ihrer Lebensdauer geschaffenen Produkte übertragen wird.
Neben der Werterhaltung der Produktionsmittel durch Wertübertragung auf die neuen Produkte, schafft das Proletariat neuen Wert, welcher der durchschnittlichen Herstellungszeit der neu geschaffenen Produkte entspricht. Dieser Neuwert entspricht zu einem Teil dem Tauschwert der Ware Arbeitskraft und zu einem Teil ist es Mehrwert, welches das Proletariat für das KleinbürgerInnentum, das Privat- und das Staatskapital produziert. Nehmen wir an der Stundenlohn für eine Proletarierin beträgt 10 Euro, produziert in dieser Zeit aber einen Wert von 20 Euro, so hat sie 10 Euro Mehrwert produziert. Ihre Ausbeutungsrate, die Mehrwertrate als Verhältnis zwischen ihrem Lohn und den von ihr produzierten Profit beträgt 100 Prozent.
Die Mehrwertrate ist interessant für proletarische RevolutionärInnen, weil sie mit deren Hilfe ein Modell der kapitalistischen Ausbeutung des Proletariats erstellen können, für die KleinbürgerInnen, KapitalistInnen, ManagerInnen und ChefInnen der Staatsbetriebe ist die Mehrwertrate uninteressant, weil die Ausgaben für Löhne nur eine Teilausgabe für sie sind und sie deshalb das Verhältnis zwischen Gesamtkapital (Kosten der Produktionsmittel/Wert des sachlichen produktiven Kapitals und den Lohnkosten/Wert des menschlichen produktiven Kapitals) und Profit wesentlich mehr interessiert. Dieses Verhältnis zwischen Gesamtkapital und Profit ist die Profitrate.
Das mehrwertproduzierende Proletariat stellt die größte Schicht dieser Klasse dar. Sie besteht aus dem Land-, dem Industrie- und einem großen Teil des Dienstleistungsproletariats. Zum Beispiel produziert der Koch eines Restaurants Wert und Mehrwert. Damit gehört der Koch zum mehrwertproduzierenden Dienstleistungsproletariat.
AusbeuterInnen des mehrwertproduzierenden Kapitals sind das KleinbürgerInnentum, das Privat- und das Staatskapital. Übrigens gehören nicht alle vom Staat beschäftigten Lohnabhängigen zum mehrwertproduzierenden Proletariat. Zu dieser Gruppe zählen zum Beispiel EisenbahnerInnen, PilotInnen und die Beschäftigten staatlicher Industriebetriebe. Im so genannten „realen Sozialismus“ war das Staatskapital das alles andere dominierende Produktionsverhältnis, weshalb wir diese Länder als staatskapitalistisch bezeichnen. Die Klasse der PrivatkapitalistInnen war zwar aufgehoben, dafür war aber der Staat an ihre Stelle bei der Ausbeutung des Proletariats getreten. Das produktive Staatskapital ist durch die „neoliberale“ Offensive des Privatkapitals weltweit seit den 1970er Jahren stark zurückgegangen.
Neben der direkten Ausbeutung des Proletariats durch den Staat, zweigt er in seiner Funktion als ideeller Gesamtkapitalist durch die Besteuerung von KapitalistInnen, KleinbürgerInnen und LohnarbeiterInnen einen Teil des privatkapitalistisch und kleinbürgerlich produzierten Mehrwertes ab. Mit diesem Mehrwert werden sowohl die BerufspolitikerInnen und hohen Beamten als Teil der herrschenden kapitalistischen Klasse, als auch jene Schicht der staatlich dienenden Lohnabhängigen bezahlt, die Teil des Proletariats bzw. des lohnabhängigen KleinbürgerInnentums sind. Die Schicht der staatlich dienenden Lohnabhängigen gehören zu jenem Teil des Dienstleistungsproletariats, was keinen Mehrwert produziert. Zu dieser Schicht gehören die unterschiedlichsten Berufe, z.B. PolizistInnen als Teil des Repressionsapparates, welche wir grundsätzlich nicht zum Proletariat sondern zum lohnabhängigen KleinbürgerInnentum zählen, aber auch proletarische Krankenschwestern in staatlichen Krankenhäusern.
Die staatlich dienenden Lohnabhängigen werden auch ausgebeutet, aber nicht wie die mehrwertproduzierenden ArbeiterInnen, um den Mehrwert zu erhöhen, sondern um die gesellschaftlich notwendigen unproduktiven Kosten der Mehrwertproduktion zu reduzieren. Wie bereits geschrieben, nährt sich der Staat vom kapitalistisch produzierten Mehrwert, von dem er z. B. Verwaltungsangestellte bezahlt. Werden jetzt Rationalisierungen im Staatsapparat durchgezogen, so dass eine kleine Büroangestellte jetzt das macht, was früher zwei taten, so werden durch die verstärkte Ausbeutung der staatlich dienenden Lohnabhängigen die unproduktiven Kosten der Staatsverwaltung als einer Bedingung der Kapitalvermehrung reduziert.
Durch die „neoliberale“ Offensive des Privatkapitals wurden viele ehemaligen staatsmonopolistischen Dienstleistungen privatisiert, was ein zahlenmäßig nicht geringes Proletariat des privatkapitalistisch organisierten Dienstleistungssektors erzeugte, welches oft extrem überausgebeutet wird.
Produzieren die ProletarierInnen des privaten Dienstleistungssektors, zum Beispiel die Krankenschwester in einem Privatkrankenhaus, Mehrwert?! Einzelkapitalistisch gesehen ja, gesamtkapitalistisch betrachtet nein. Die Krankenschwester eines privatkapitalistisch betriebenen Krankenhauses produziert Profit für ihr Unternehmen, indem sie die Kranken behandelt. Aber woraus wird die Krankenschwester vorwiegend bezahlt? Aus Geldern aus privaten und gesetzlichen Krankenkassen, und damit vorwiegend aus dem Bruttolohn proletarischer und kleinbürgerlicher Lohnabhängiger sowie aus den „Arbeitgeberanteilen“ der Krankenversicherung. Sowohl die proletarischen bzw. lohnabhängig- kleinbürgerlichen als auch die „Arbeitgeberanteile“ zur Krankenversicherung gehören zum Preis der Ware Arbeitskraft, also zu den Lohnkosten. Krankenschwestern, egal ob in staatlichen oder privaten Krankenhäusern arbeitend, werden also vorwiegend aus dem Lohn des Proletariats bezahlt. Der Profit eines privaten Krankenhauskonzerns stellt zum wesentlichen Teil – von den Dienstleistungen, welche die Krankenkassen nicht bezahlen, mal abgesehen – also einen indirekten Abzug vom Lohn des Proletariats dar, während die Behandlung und der Lohn der Krankenschwestern einen „legitimen“ Teil der Sozialversicherung des Proletariats bilden. Die kapitalistische Ausbeutung der Krankenschwestern im Privatkrankenhäusern dient dazu, den Profit des Krankenhausbesitzers zu vergrößern, der gesamtgesellschaftlich gesehen keinen Teil des Mehrwertes darstellt, sondern einen Lohnbestandteil des Proletariats und der lohnarbeitenden KleinbürgerInnen. Die Dienstleistung der Krankenschwester ist notwendig für die Mehrwertproduktion, damit krank gearbeitete LohnarbeiterInnen wieder „gesund“ für die krankmachende Mehrwertproduktion werden, eine unproduktive Kost der Mehrwertproduktion.
Eine weitere Schicht des Proletariats bilden die mehrwertrealisierenden Lohnabhängigen, also jene ProletarierInnen die für das Kapital Waren in Geld verwandeln und damit ihren Mehrwert realisieren (z.B. VerkäuferInnen in einem Supermarkt), Lohnabhängige im Finanzwesen, welche den Profit des Finanzkapitals realisieren helfen und die Mehrwertproduktion und –realisation verwaltende Lohnabhängige (z. B. Büroangestellte).
Alle Lohnabhängige des letzten Absatzes produzieren keinen Mehrwert, haben aber für die Mehrwertproduktion eine sehr wichtige Funktion. Ihre Ausbeutung dient dazu, um die notwendigen unproduktiven Kosten der kapitalistischen Produktion zu senken.
In gar keinem Verhältnis zur Mehrwertproduktion stehen die privat dienenden Lohnabhängigen, z. B. die Putzfrau in der Privatvilla eines Kapitalisten. Sie produziert keinen Profit, sondern nur einen Gebrauchswert, nämlich eine saubere Privatbehausung für den Kapitalisten, welche er mit einem Teil des Mehrwertes konsumiert. Dieser Teil des Mehrwertes ist für die kapitalistische Produktion verloren, er wurde für die biosoziale Reproduktion des Kapitalisten ausgegeben, im Gegensatz zu dem Teil des Mehrwertes, der dazu verwendet wird, um neue Maschinen zu kaufen und noch mehr Lohnarbeit anzumieten, der also zur weiteren Kapitalvermehrung dient.
Ebenfalls zum Proletariat gehören die persönlich unfreien ArbeiterInnen, die keine doppelt freien LohnarbeiterInnen sind. Zu ihnen gehören ArbeiterInnen in den verschiedenen Gefängnissen, wehrpflichtige SoldatInnen und Zivildienstleistende aus dem proletarischen Milieu und vom Sozialstaat zwangsrekrutierte ArbeiterInnen (Ein-Euro-Jobber)
Alle arbeitenden Schichten des Proletariats werden von KleinbürgerInnentum, Privat- und Staatskapital ausgebeutet. Ausbeutung ist nicht nur eine sozialökonomische Tatsache, sondern auch eine sozialpsychologische Zumutung. Die eigene Arbeitskraft vermieten zu müssen, heißt von der eigenen produktiven Tätigkeit entfremdet zu sein.
Die bewusste produktive Tätigkeit unterscheidet die Menschheit vom Tierreich. Wer seine Fähigkeit zur produktiven Tätigkeit an das KleinbürgerInnentum, das Kapital und den Staat vermietet, kann nicht wirklich über sich selbst bestimmen, über den wird bestimmt. Was und wie er/sie produziert, bestimmt in der Regel nicht der/die Proletarier/in, sondern die MieterInnen der proletarischen Arbeitskraft.
Was produziert wird, interessiert die LohnarbeiterInnen in der Regel nicht wirklich. Es hat oft nichts mit ihrer besonderen Bedürfnissen zu tun. Auch die MieterInnen ihrer Arbeitskraft interessiert in den meisten Fällen nicht das Produkt der proletarischen Arbeit. Sie verkaufen bzw. lassen es von Lohnabhängigen auf dem Markt verkaufen. Mit dem damit realisierten Geld bezahlen sie auch die gemietete Arbeitskraft. In den Händen der proletarisierten Menschen ist dieser Tauschwert ihrer vermieteten Arbeitskraft das eigentliche Ziel ihrer produktiven Tätigkeit.
Wenn der proletarisierte und in der Stadt sozialisierte Mensch sein Bedürfnis nach Nahrung befriedigt, geht er nicht einer produktiven Tätigkeit nach, der diese Bedürfnisse direkt befriedigt, er geht abstrakt „arbeiten“ für Geld, um mit diesem Geld sich Lebensmittel zu kaufen. Ob er nun hämmert, Akten sortiert, an der Kasse sitzt oder Bus fährt, der proletarische Mensch arbeitet letztendlich für Geld. In dem bedruckten Papier, das er im Tausch für seine vermietete Arbeitskraft erhält, sind alle Spuren der konkreten produktiven Tätigkeit ausgelöscht. Wenn sich ProletarierInnen unterhalten, fragen sie sich nicht gegenseitig in erster Linie, welcher produktiven Tätigkeit sie nachgehen, sondern ob sie überhaupt „Arbeit“ haben und wie hoch der Lohn ist. In der „Arbeit“ für Geld ist von der konkreten produktiven Tätigkeit abstrahiert, die abstrakte „Arbeit“ für Geld ist die spezifische proletarische Entfremdung von der eigenen produktiven Tätigkeit.
Der proletarisierte Mensch wendet nicht die Produktionsmittel an, um mit ihnen ein Produkt seiner Bedürfnisse zu produzieren, er wird vom Kapital gemietet und an das Produktionsmittel gestellt, um eine Ware für einen anonymen Markt herzustellen. Der proletarisierte Mensch ist nicht Subjekt seiner Bedürfnisproduktion, er ist Objekt der Kapitalvermehrung.
Die proletarische Entfremdung von der eigenen produktiven Tätigkeit und deren Realabstraktion zur „Arbeit“ für Geld prägt den ganzen Alltag der LohnarbeiterInnen. ProletarierIn sein heißt unter anderem: früh am Morgen aus den schönsten Träumen gerissen zu werden, den Wecker verfluchen und dennoch aufstehen, im Bus zur Arbeit fahren, die gleichen müden Gesichter sehend, ankommen an der Arbeit, dabei immer stärker von sich selbst entfernend, Dinge produzieren, die mensch sich nie selbst leisten kann, tausend mal auf die Uhr schauend, warten auf das Frühstück, das Mittagessen, auf den Feierabend, endlich raus aus der Bude, doch oft zur kreativen Freizeitgestaltung zu ausgepowert, zu fertig… also vor die Glotze, Stumpfsinnig konsumierend bis zum Schlafen gehen…
Das alles und noch viel mehr (Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, Mobbing am Arbeitsplatz, Lärm, Gestank, Überwachung…), heißt es Proletarier/in zu sein und von KleinbürgerInnentum, Privat- und Staatskapital ausgebeutet zu werden.
Dieses ausgebeutete Proletariat ist die Hauptproduktivkraft der kapitalistischen Gesellschaft, die zugleich selbst zerstörerisch gegen sich wirkt und für die natürliche Umwelt ein latentes Vernichtungs- und Vergiftungsrisiko birgt. Das Proletariat produziert unter dem Kommando des Kapitals Atombomben, Milliarden Tonnen Treibhausgase pro Jahr…
Es produziert Luxusgegenstände, die es sich selbst kaum leisten kann, für das KleinbürgerInnentum und Staat, für sich selbst produziert es eine Menge Gammelfleisch und Glasperlen, die es nicht wirklich braucht, wie das neue Handy mit wieder mehr überflüssigen Funktionen, aber die menschliche Arbeitskraft und natürliche Ressourcen kosten, während andererseits wichtige Dinge von ihm viel zu wenig produziert werden. Das Proletariat produziert die Automobile für den gefährlichen, verschwenderischen und nicht selten tödlich verlaufenden Individualverkehr. Die proletarisierten Menschen produzieren die Gummiknüppel, welche andere ProletarierInnen, wenn sie sich wehren, von Bullen abbekommen. Das Weltproletariat produziert das Weltkapital, deren Macht und Reichtum und damit seine eigene Ohnmacht. Je mehr Kapital es produziert, um so weniger bleibt von ihm selbst übrig.
Nein, es gibt keinen Grund das Proletariat in seiner Eigenschaft als Hauptproduktivkraft unserer Zeit zu idealisieren. Denn es ist zugleich die Hauptdestruktivkraft unsere Zeit, die sich unter dem Kommando des Kapitals selbst zu zerstören droht. In seiner sozialen Eigenschaft als Ausbeutungsobjekt lässt sich das Proletariat viel zu oft viel zu viel gefallen. Aber das Kapital kennt bei seinem kategorischen Imperativ „Vermehre mich!“ keine Gnade und kein Erbarmen. Es will vom Proletariat viel mehr, als es geben kann. Der proletarische Klassenkampf wird zu einer reproduktiven Notwendigkeit. Ohne seinen Widerstand, hätte das Kapital das Proletariat als Kollektiv schon sprichwörtlich zu Tode gehetzt, so wie es schon unzählige ProletarierInnen als Individuen auf dem Altar der Profitvermehrung geopfert hat. Nur durch ihren Klassenkampf kann die proletarisierte Menschheit ihre Ausbeutungsobjektivität etwas abmildern – aber auch perspektivisch ganz aufheben.
…..
Die Reproduktion des Proletariats erfolgt nach der Arbeit und vorwiegend nicht kollektiv als Klasse sondern individuell oder familiär. Auch als Familienmenschen sind ProletarierInnen ganz bestimmt nicht zu idealisieren, so wenig wie die bürgerliche Kleinfamilie generell zu idealisieren, sondern revolutionär aufzuheben ist.
Auch in proletarischen Familien gibt es patriarchale Ausbeutung, Gewalt und Unterdrückung. Die moderne Hausfrau ist auch in nicht wenigen proletarischen Familien die Synthese aus jahrtausendealter Frauenunterdrückung und Kapitalismus. Auch in der heutigen bürgerlichen Klassengesellschaft ist biosoziale Reproduktion der Menschheit noch vorwiegend Frauensache. Auch der lohnarbeitende Mann reproduziert sich noch allzu oft auf Kosten „seiner“ Frau. Letztendlich profitieren davon die kleinbürgerlichen, privat- und staatskapitalistischen MieterInnen der männlichen Arbeitskraft. Erstens ist eine Arbeitskraft, die daheim ausruhen kann, wesentlich einsatzfähiger auf Arbeit, zweitens verbilligt die unterbezahlte Arbeitskraft der Hausfrau die männliche Arbeitskraft. Denn würde der proletarische Mann alle Tätigkeiten „seiner“ Frau durch bezahlte Dienstleistungen ersetzen, würde sein Lohn kaum reichen. Die Hausfrau erledigt die biosoziale Reproduktion des Proletariats letztendlich im Interesse des Kapitals wesentlich billiger.
Sie reproduziert die Arbeitskraft ihres Mannes und ihre eigene Hausarbeitskraft für einen Teil des männlichen Lohnes – sowohl in Geld- als auch in Naturalform. Sie reproduziert wesentlich die Arbeitskraft „ihres“ Mannes, den nicht sie, sondern er an das Kapital vermietet. Während die meisten LohnarbeiterInnen ihre Arbeitskraft an eine anonyme Kraft vermieten, „ihre“ KapitalistInnen oft also nicht persönlich kennen, ist den meist weiblichen innerfamiliären HausarbeiterInnen ihr familiärer Ernährer/in nur zu gut bekannt. Die Hausarbeit ist eine zutiefst individualisierende und stumpfsinnige Tätigkeit. Sie wird auch nicht emanzipatorischer, wenn in Mittelstandsfamilien, die Frau Karriere macht und der Mann zu Hause bleibt.
Sozial gesehen ist dass Spannungsverhältnis zwischen den meist männlichen LohnarbeiterInnen und den meist weiblichen innerfamiliären HausarbeiterInnen ein innerproletarischer Widerspruch, wo meistens er sie zu Hause ausbeutet und er im Betrieb ausgebeutet wird. Die Ausbeutung der weiblichen innerfamiliären Hausfrau durch nicht wenige männliche Lohnarbeiter, zählt zu den reaktionärsten Tendenzen des Proletariats.
Neben der klassischen Form, dass er im Betrieb arbeitet und sie zu Hause bzw. die angeblich „emanzipatorische“ Form, welche die Herzen der Mittelstandsfeministinnen höher schlagen lässt, in der das ganze Dilemma anders rum organisiert wird, gibt es noch verschiedene Mischformen. Zum Beispiel die, dass sie neben der Lohnarbeit auch noch zu Hause den Löwenanteil der biosozialen Reproduktion erledigen muss. Sie ist dann Lohnarbeiterin und innerfamiliäre Hausarbeiterin in einem, wird also doppelt ausgebeutet. Dass auch im modernen, aufgeklärten Deutschland die Löhne von Frauen im Durchschnitt 23 Prozent niedriger sind als die von Männern, zementiert die „klassische“ Arbeitsteilung innerhalb des Proletariats.
Die bürgerliche Kleinfamilie gehört revolutionär aufgehoben. Für revolutionäre ProletarierInnen sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass bis zum Sieg der Weltrevolution in allen Formen des Zusammenlebens die Hausarbeit zwischen den Geschlechtern geteilt werden muss. Später, nach der möglichen siegreichen Revolution, muss die biosoziale Reproduktion der Menschheit weitgehend entindividualisiert und durch kollektivere Formen des Zusammenlebens sozialisiert werden.
…..
Außerhalb des Klassenkampfes sind die ProletarierInnen KleinbürgerInnen, nur innerhalb des Klassenkampfes sind sie potenziell revolutionär. Allerdings ist die Klassenkampfsubjektivität ein fester Bestandteil der proletarischen Identität. Wie groß ihre Marktsubjektivität und die Extensivität/Intensität ihrer Ausbeutungsobjektivität sind, hängt im großen Maße von der Klassenkampfsubjektivität der proletarisierten Menschen ab. Das Kapital hat die Tendenz die Marktsubjektivität des Proletariats auf unerträgliche Weise herabzumindern, so wie es grenzenlos in seinem Streben nach dessen maximaler Ausbeutung ist. Der proletarische Klassenkampf wird zu einer reproduktiven Notwendigkeit für das Proletariat selbst.
Nicht nur für das Proletariat selbst, sondern auch für seine MieterInnen, die KleinbürgerInnen, die KapitalistInnen, ManagerInnen und PolitikerInnen. Würde sich das Proletariat unter dem Regime der kapitalistischen Ausbeutung zu Tode arbeiten, gäbe es auch kein Kapital und keinen bürgerlichen Staat mehr. Denn beide leben vom Proletariat. Indem das Proletariat um seine Existenz kämpft, kämpft es somit auch für die Existenz von Kapital und Staat. Das ist das Paradoxe des reproduktiven Klassenkampfes.
Allerdings wenn das Proletariat „zu anspruchsvoll“ ist, und für mehr kämpft als für die Reproduktion seiner Existenz, kann es die Profitabilität der kapitalistischen Produktion gefährden. Dass ist die zweite Wahrheit des reproduktiven Klassenkampfes.
Allerdings kann durch den reproduktiven Klassenkampf, der lediglich darauf zielt die Marktsubjektivität zu erhöhen bzw. die Ausbeutungsobjektivität des Proletariats zu senken, nicht der Kapitalismus zum Zusammenbruch gebracht werden. Nur die bewusste revolutionäre Selbstaufhebung des Proletariats vermag Kapital, Staat und Patriarchat zu zerschlagen. Die Charaktermasken des Kapitals (KapitalistInnen, ManagerInnen und großbürgerliche BerufspolitikerInnen) antworten mit ihren Strategien auf den proletarischen Klassenkampf. Durch diesen Klassenkampf erneuert sich der Kapitalismus im Weltmaßstab permanent.
Gelingt es zum Beispiel dem Proletariat in bestimmten Situationen durch Klassenkampf eine Verkürzung der Arbeitszeit zu erreichen, setzen die StrategInnen des Kapitals auf eine Arbeitsverdichtung, so dass die ArbeiterInnen in kürzerer Zeit mehr Profit produzieren. Erreichen bestimmte proletarisierte Menschen durch ihren aktiven Kampf eine Erhöhung der Löhne, kann es sein, dass durch diesen Anstieg der Lohnkosten Maschinen lukrativ erscheinen, die früher als zu teuer galten. Außerdem wird ein großer Teil des nominellen Lohnanstieges durch den Preisanstieg/die Geldentwertung wieder gefressen.
Gefährdet in sehr guten Situationen, zum Beispiel bei Arbeitskräfteknappheit, der proletarische Klassenkampf wirklich einmal die kapitalistische Profitabilität, setzen die Charaktermasken des Kapitals in diesem entsprechenden Land bzw. Kontinent auf den Kapitalexport in so genannte „Billiglohnländer“. Durch den Kapitalexport steigt in dem „Fluchtgebiet“ die Arbeitslosigkeit an, deren Druck wiederum die Löhne sinken lässt. Außerdem führt das Sinken der Mehrwertrate durch vorübergehenden erfolgreichen reproduktiven proletarischen Klassenkampf dazu, dass das Kapital zunehmend aus der Produktion in die Finanzspekulation verlagert wird.
Der reproduktive Klassenkampf kann also für das Proletariat nur in Aufschwungszeiten und nur bis zu dem Augenblick offensiv geführt werden bis er ernstlich die Profitabilität des Kapitals gefährdet. Entweder geht das Proletariat zum revolutionären Klassenkampf über, oder das Kapital holt sich in einer erfolgreichen Gegenoffensive dreifach das zurück, was es während der proletarischen Offensive verloren hat.
Der reproduktive Klassenkampf kann also auf Dauer vom Proletariat nicht erfolgreich geführt werden. Eine langfristige offensive „Lohnpolitik“ ist eine Unmöglichkeit. Notwendig ist eine proletarische Offensive gegen die Lohnarbeit.
Diese proletarische Offensive gegen die Lohnarbeit setzt sich potenziell und tendenziell schon im reproduktiven Klassenkampf durch. Der Kampf gegen die Arbeit ist in den versteckten Formen des Klassenkampfes alltäglich und allgegenwärtig: Langsamarbeiten, Krankfeiern trotz bester Gesundheit, Sabotageaktionen…
Auch die sichtbare Form des Klassenkampfes, der Streik, ist eine Flucht aus der Arbeit. Zwar wird die Arbeit vom streikenden Proletariat unterbrochen, um sie für eine erhöhte Marktsubjektivität bzw. gesenkte Ausbeutungsobjektivität wieder aufzunehmen, aber die Arbeitsniederlegung als solche ist eindeutig eine revolutionäre Tendenz des reproduktiven Klassenkampfes, während deren Wideraufnahme für ein Linsengericht die konservative Tendenz darstellt. Proletarische RevolutionärInnen nehmen bewusst am reproduktiven Klassenkampf teil, um deren progressiven Tendenzen zu stärken und die konservativ-reaktionären zurück zu drängen.
Demgegenüber verkörpert die institutionalisierte ArbeiterInnenbewegung (Gewerkschaften und sozialdemokratische/„kommunistische“ „ArbeiterInnenparteien“ die konservativ-reaktionären Tendenzen des reproduktiven Klassenkampfes.
Sozialdemokratische und „kommunistische“ Parteien integrieren die ArbeiterInnen in die Demokratie, welche nur – neben Faschismus, Militärdiktaturen und islamistische Theokratien –eine politische Herrschaftsform der sozialen Diktatur des Kapitals ist. Politik kann nur kleinbürgerlich-reaktionär, aber niemals proletarisch-revolutionär sein. Die kleinbürgerlichen BerufspolitikerInnen sozialdemokratischer und „kommunistischer“ „ArbeiterInnenparteien streben in stabilen Demokratien danach von der Bourgeoisie voll anerkannt zu werden. Erreichen sie dieses Ziel, verwandeln sie sich in großbürgerliche PolitikerInnen. Den MarxistInnen-LeninistInnen gelang in Osteuropa und in einigen Ländern des Trikont den Sturz der Bourgeoisie und die Errichtung eines staatskapitalistischen Regimes. Die „kommunistischen“ Parteibürokratien verwandelten sich in solchen Regimes in sozialökonomisch herrschende Klassen. Diese Entwicklung ist keine Folge des „Stalinismus“, wie uns die TrotzkistInnen einreden wollen. Die staatskapitalistische Konterrevolution setzte sich schon ab der Oktoberrevolution im Jahre 1917 unter Lenin und Trotzki gegen die proletarische Selbstorganisation (verkörpert in den ArbeiterInnenräten und Fabrikkomitees) durch. Ideologisch wurde diese staatskapitalistische Konterrevolution schon durch die reaktionären Tendenzen bei Marx und Engels vorbereitet.
In einigen Ländern vollzog sich die ursprüngliche Industrialisierung in staatskapitalistischen Formen unter der politisch-ideologischen Herrschaft des Marxismus-Leninismus. Doch der Staatskapitalismus stellte sich spätestens mit der mikroelektronischen dritten industriellen Revolution als Hemmnis für die weitere kapitalistische Entwicklung heraus. Diese Hemmnisse wurden vom Privatkapital gesprengt – nicht selten unter aktiver Mithilfe der sozialdemokratisch gewendeten ehemaligen MarxistInnen-LeninistInnen.
Gewerkschaften führen den Kampf um eine höhere Marktsubjektivität und eine Ausbeutungsobjektivität des Proletariats, die ausreicht um dessen Reproduktion und damit auch die Reproduktion des Kapitalismus zu sichern. Sie verwalten die Inwertsetzung der Arbeitskraft mit, sie können folglich kein Mittel zur Zerschlagung von Kapital, Staat und Patriarchat sein. Gegenteilige Behauptungen von marxistischen und anarchosyndikalistischen GewerkschaftsideologInnen werden permanent in der Praxis widerlegt.
Der Beginn der Gewerkschaftsbewegung war mit starker innerbetrieblicher und staatlicher Repression verbunden. Auch heute noch stoßen in bestimmten Staaten und Betrieben, oder auch „radikalere“ Gewerkschaften in ansonsten gewerkschaftsfreundlichen Staaten und/oder Betrieben auf Repression. Aber inzwischen ist in der Regel von Kapital und Staat der übertriebenen Repression, die nur zu einer unnötigen Radikalisierung von Teilen des Proletariats führen kann, der Integration von Gewerkschaften in die Betriebs/Wirtschaftsdemokratie, also in die Diktatur des Kapitals, gewichen. In Deutschland sind zum Beispiel die Mitgliedsgewerkschaften des DGB tief in Kapital, Staat und Patriarchat integriert. Die obersten Spitzen der Gewerkschaftsbürokratien bilden die unterste Schicht der herrschenden kapitalistischen Klasse.
Durch Tarifverträge, in denen die wichtigsten Arbeitsbedingungen, wie Lohn, Arbeitszeit und Urlaub, zwischen Kapitalverbänden und den Gewerkschaften geregelt werden, entwickelten sich die GewerkschaftsbürokratInnen zu Co-ManagerInnen der Ware Arbeitskraft/ des menschlichen produktiven Kapitals. Das Tarifrecht ist Teil des praktizierten bürgerlichen Rechtes, welches vom Staat gewahrt, bewacht und durchgesetzt wird. Durch die Anerkennung des Tarifrechtes und das grundsätzliche Streben nach Tariffähigkeit ist eine Gewerkschaft bereits staatsbejahend, auch wenn sie noch keinen einzigen Tarifvertrag unterzeichnet hat und noch auf starken kapitalistischen/staatlichen Widerstand stößt, so wie die anarchosyndikalistische FAU. Während der Laufzeit eines Tarifvertrages herrscht Friedenspflicht, die den Tarifvertrag unterzeichnende Gewerkschaft nimmt also an der Befriedung des Proletariats und die Verwandlung des unberechenbaren Klassenkampfes in vorhersehbare Tarifrituale teil. Das Tarifsystem beinhaltet also keine „Gefahren der Korrumpierung“ wie unsere anrchosyndikalistischen IdeologInnen so treuherzig behaupten, es ist die institutionalisierte Korrumpierung, die Erziehung von ProletarierInnen in gute demokratische Staatsbürgerinnen, die nicht mehr in erster Linie für sich selbst kämpfen, sondern dies ihren dazu vorgesehenen VertreterInnen überlassen. Die in praktischer Hinsicht (noch?) recht erfolglose FAU agiert bereits jetzt so realpolitisch und legalistisch, dass sie sich kaum noch vom DGB unterscheidet. Nur das Gelaber über „Basisdemokratie“ unterscheidet die anarchosyndikalistischen KleinbürgerInnen noch etwas von den DGB-GroßbürokratInnen. Die AnarchosyndikalistInnen wollen demokratischer als die herrschenden DemokratInnen sein, und sind doch nur armselige HofnärrInnen der Diktatur des Kapitals.
Ein weiteres Organ der Betriebs/Wirtschaftsdemokratie als Diktatur des Kapitals ist der Betriebsrat/Personalrat. Er wird von den „ArbeitnehmerInnen“ demokratisch, gewählt, stellt also so etwas wie praktizierte „ArbeiterInnendemokratie“ dar, ist dem Betriebsfrieden und dem Streikverbot unterworfen, dient also letztendlich zur Befriedung und Integration der ArbeiterInnen, so wie der Parlamentarismus in der politischen Sphäre.
In den Betriebsräten spielen die Gewerkschaften dieselbe Rolle, wie die Parteien im Deutschen Bundestag. Sie konkurrieren auf verschiedenen Listen um die Gunst der proletarischen WählerInnen, und nehmen so in konkurrenzförmiger Art und Weise mehr oder weniger bewusst an der Zähmung der Klassenkampfsubjektivität des Proletariats teil, auch die linken Betriebsräte innerhalb der DGB-Gewerkschaften oder der syndikalistischen Konkurrenz von der I.W.W. Germany. Betriebsräte verkörpern die institutionalisierte Sozialpartnerschaft, eine Form der „ArbeiterInnendemokratie“, die am Tropf des Kapitals hängt. Proletarische RevolutionärInnen haben in ihnen nichts zu suchen, wenn sie auch solche Institutionen auch manchmal begrenzt für ihren eigenen reproduktiven Klassenkampf nutzen können. Aber sie lassen sich nie und nimmer in Betriebs/Personalräte wählen oder rufen zu deren Wahl auf.
Nein, wir konkurrieren nicht mit den DGB-Gewerkschaftsbonzen, welche die Betriebsräte in der Praxis dominieren, innerhalb ihres Biotop, der Betriebs- und Wirtschaftsdemokratie, sondern setzen auf die proletarische Selbstorganisation im Klassenkampf und auf deren militante Form, die Diktatur des Proletariats. Diese entwickeln sich bereits embryonal im reproduktiven Klassenkampf. Ihr sichtbarster Ausdruck ist der wilde Streik, welcher die Friedenspflicht des Tarifschachers missachtet und nicht von der Gewerkschaftsbürokratie im Interesse des Kapitals desorganisiert, sondern vom kämpfenden Proletariat selbst organisiert wird. Das sozialreaktionäre Streikmonopol der Gewerkschaftsbürokratie, welches real ein Streikverbot für das selbstorganisierte Proletariat darstellt, wird gebrochen. Auch schon in offiziell noch von DGB-Gewerkschaften „geführten“ bzw. gebremsten Klassenkämpfen kann sich eine Doppelherrschaft von Gewerkschaften und proletarischer Selbstorganisation herausbilden.
Die DGB-Gewerkschaften sind bürokratisch entfremdete Ausdrücke des reproduktiven Klassenkampfes des Proletariats. Doch die Gewerkschaftsbürokratie vertritt objektiv ihre eigenen Interessen als Teil der herrschenden kapitalistischen Klasse, als Co-Managerin des menschlichen produktiven Kapitals. Die konkrete Gewerkschaftspolitik ist abhängig von den Verwertungsbedingungen des Kapitals (Aufschwung oder Krise), der staatlichen Politik (Repression oder Integration) und dem Druck der proletarischen Basis (mehr oder weniger kämpferisch) abhängig. Der Widerspruch zwischen Gewerkschaftsbürokratien und dem Proletariat kann sich im reproduktiven Klassenkampf nur bewegen und entwickeln, gelöst werden kann er nur durch die revolutionäre Zerschlagung der Gewerkschaftsbürokratien.
…..
Trotz Gewerkschaften, Sozialdemokratie und Partei-„Kommunismus“ ist auch in den demokratischen Metropolen der reproduktive Klassenkampf des Proletariats nicht frei von revolutionären Tendenzen. Revolutionäre Tendenzen des reproduktiven Klassenkampfes sind solche, welche die Grundlagen des proletarischen Elends und des kapitalistischen Reichtums angreifen: den kapitalistische Charakter der Produktionsmittel (sachliches produktives Kapital), den Kapitalcharakter der eigenen Arbeitskraft (menschliches produktives Kapital) und den Warencharakter der Produkte. Um diesem Elend für ein paar Minuten zu entkommen, muss der kapitalisierte/proletarisierte Mensch sich selbst tendenziell entproletarisieren, indem er im kapitalistischen Produktions- und Verwertungsprozess nicht brav den Profit vermehrt, sondern subversiv krankfeiert, die kapitalistischen Produktionsmittel für den eigenen Nutzen verwendet und sich Produkte unentgeltlich aneignet. Auch wenn es sich dieser revolutionären Tendenzen meistens nicht bewusst ist, so handelt doch dass Proletariat instinktiv radikal, indem sie die Wurzeln des Kapitalismus angreift.
Die Proletarierin in einer Holzwerkstatt, die immer dann, wenn der Chef nicht hinguckt, eigene Gebrauchsgegenstände für sich herstellt, hebt für diese Augenblicke den Kapitalcharakter der Produktionsmittel auf. Der Produktionshelfer, dem die Maschine den letzten Lebensnerv raubt und sie phantasiereich außer Gefecht setzt – so dass seine Sabotage nicht bemerkt wird – zerstört für eine Atempause kapitalistische Zerstörungsmittel. Die ArbeiterInnen in einem Lebensmittelbetrieb, welche sich die Produkte ihrer Arbeit illegal und unentgeltlich aneignen, heben den Warencharakter einiger Produkte ihrer Arbeit auf…
Allerdings wird das proletarische Elend durch diese revolutionären Tendenzen, die sich oft instinktiv und vorbewusst durchsetzen, nur ein wenig abgemildert. Das proletarische Elend für immer aufzuheben, ist nur durch die bewusste soziale Weltrevolution – die globale revolutionäre Selbstaufhebung des Proletariats – möglich.
Neueste Kommentare